Die Bildsprache der Macht: Politiker in Szene gesetzt
 Politik ohne Bilder ist kaum denkbar. Das Bad in der Menge oder winkend
Politik ohne Bilder ist kaum denkbar. Das Bad in der Menge oder winkend
vom Balkon – diese Fotos von Politikern begegnen uns täglich in den
Medien. Keines dieser Motive ist zufällig, alle dienen sie dem Zweck,
einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Wie präsentieren sich
Führerfiguren? Kommunikations-Designer Michael Brenner untersuchte in
seiner Abschlussarbeit „Die Bildsprache politischer Macht“, wie
Machtpositionen bildlich inszeniert werden. Die Arbeit wird auf der
Werkschau der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim am 10.
und 11. Februar 2017 vorgestellt. Die Werkschau präsentiert die Semester-
und Abschlussarbeiten der rund 700 Designstudierenden.
Die politischen Entwicklungen in der Türkei, Frankreich und den
Niederlanden waren es, die Michael Brenner zu seinem Bachelor-Thema
führten: „Mich interessiert, wie sich dieser Populismus in der visuellen
Kommunikation niederschlägt – und wo deren Anfänge zu suchen sind“. Der
Designer wurde in den 1930er Jahren fündig. Mit der Entwicklung der
Massenmedien konstituierte sich eine neue politische Kommunikation der
politischen Persönlichkeiten. Für Michael Brenner stellte sich die Frage:
„Gibt es Parallelen in der damaligen und heutigen Bildsprache?“
„Erschreckend viele“, sagt der 28-Jährige. Für seine Publikation hat er
Fotografien von Hitler, Stalin, Roosevelt und Mussolini gesichtet. Im
zweiten Schritt untersuchte er die offiziellen Twitter-, Facebook- und
Instagram-Kanäle von Barack Obama, Recep Erdogan, Baschar al-Assad und
Donald Trump. Die von ihm genutzten Bildkategorien – Motive mit Kindern,
das Bad in der Menge, Volksnähe und militärische Motive – zeigen, wie sich
diese Politiker abbilden ließen. Bei Donald Trump und Barack Obama sind
die Motive mit Kindern am häufigsten, Recep Erdogan zieht Fotos mit
Massenovationen vor. „Aber“, erklärt der Designer, „die inszenierte
Privatheit ist das wichtigste Motiv.“ Bilder von Adolf Hitler im
Liegestuhl oder bei der Zeitungslektüre vermitteln scheinbar Einblicke in
den persönlichen Bereich. Er lässt den Betrachter durch ein
„Schlüsselloch“ blicken. In diese Kategorie ordnet Michel Brenner auch das
Motiv „Politiker mit Hund“ ein. Die Kontinuität dieser Bildsprache reicht
von Adolf Hitler, der sich mit seiner Schäferhündin Blondi ablichten ließ,
bis hin zu heutigen Mächtigen.
Die Abschlussarbeit von Michael Brenner zeigt nicht nur, wie seit vielen
Jahrzehnten mit den gleichen bildsprachlichen Mitteln gearbeitet wird,
sondern nimmt auch den Konsumenten „unter die Lupe“. „Auch unser Bedürfnis
nach Nähe und Privatheit hat sich nicht verändert – und es wird von einer
großen Schar Fotografen weiterhin bedient“, fasst er zusammen. Ein
verändertes Verhalten ist nach seiner Ansicht nicht in Sicht. Das
Verhältnis zwischen Akteur und Betrachter bleibt gleich. Politiker
inszenieren sich, Fotos werden arrangiert und auf bestimmte Ziele
ausgerichtet. Auch aufgeklärte Leser und Zuschauer akzeptieren diese
Bildsprache und hinterfragen die Szenen nur selten.
Der Prototyp der Publikation wird am 10. und 11. Februar 2017 im Rahmen
der Werkschau der Fakultät für Gestaltung zu sehen sein. Die Arbeiten der
Studierenden aus den sechs Bachelor- und zwei Masterstudiengängen sind in
den Räumen der Fakultät, Holzgartenstraße 36, im EMMA-Kreativzentrum
(Accessoire Design) und in der Eutinger Straße 111 (Transportation Design)
zu sehen. Die fünf Modenschauen finden am Freitag, 10. Februar 2017, um 19
und 21 Uhr sowie am Samstag, 11. Februar 2017, um 17, 19 und 21 Uhr in der
Aula der Fakultät statt.
- Aufrufe: 174
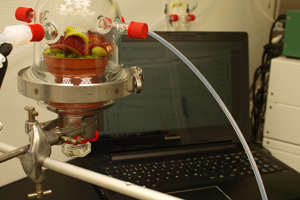 Wissenschaftler zeigen, dass die Venusfliegenfalle Stickstoff-Verbindungen
Wissenschaftler zeigen, dass die Venusfliegenfalle Stickstoff-Verbindungen Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger in der Universität
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger in der Universität