Saunapreise in Deutschland: Frankfurt und Duisburg am teuersten, Bochum und Wuppertal mit am günstigsten
- Große Preisunterschiede bei den Tarifen in den 21 einwohnerstärksten Städten Deutschlands
- Frankfurt am Main verlangt mit mindestens 32,50 Euro mit Abstand die teuersten Eintrittspreise, gefolgt von Duisburg mit 22,00 Euro
- Bochum und Wuppertal gehören mit 9,00 bzw. 10,00 Euro mit zu den günstigsten Städten
- In Berlin variieren die Tarife von 8,50 Euro bis 22 Euro
Winterzeit ist Saunazeit. Wenn es draußen stürmt und schneit, zieht der wohlig heiße Dampf rund 30 Millionen Deutsche regelmäßig in die Sauna. Netzshopping hat aus diesem Anlass die Eintrittspreise von kommunal betriebenen Saunen und Schwimmbädern in den 21 einwohnerstärksten Städten Deutschlands verglichen und herausgefunden: Städteabhängig kann die Preisdifferenz mehr als 30 Euro betragen. Frankfurt am Main hat dabei mit mindestens 32,50 Euro bis hin zu 38,00 Euro mit Abstand den teuersten und Karlsruhe mit sieben Euro den erschwinglichsten Eintrittspreis für Sauna und Schwimmbad.
Neben der Siegerstadt Karlsruhe können sich auch die Eintrittspreise in Hannover und Berlin sehen lassen. Mit jeweils 8,50 Euro liegen die beiden Großstädte gemeinsam auf dem zweiten Platz der günstigsten Preise. Dicht gefolgt von Bochum, hier zahlt man 9 Euro für die Tageskarte. Damit hat Bochum mit Abstand die günstigsten Preise im Ruhrpott. Im zirka 20 Kilometer entfernten Dortmund müssen Saunabesucher bereits 19,50 Euro berappen und in Duisburg sogar 22,00 Euro. Aber auch südlich des Ruhrgebiets dürfen Saunafreunde sich freuen. Für 10,00 Euro können die Wuppertaler in der Schwitzkabine entspannen. Ein Blick über die Stadtgrenze kann sich also lohnen.
Bei den Top 10 der einwohnerstärksten Städte Deutschlands liegt Berlin auf dem ersten Platz der günstigsten Eintrittspreise für Sauna und Schwimmbad.
Auffällig ist, dass sowohl in Berlin als auch in Karlsruhe die Preisspanne weit gefächert ist. In Berlin reicht sie von 8,50 bis 22,00 Euro, in Karlsruhe sogar von 7,00 bis 23,00 Euro. Die Differenz beträgt in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs somit rund 16 Euro.
In München ist die Preisspanne wenn es um das Saunieren und Baden geht ebenfalls weit auseinander. Für den günstigsten Eintrittspreis zahlen Saunaliebhaber hier bereits 17,30 Euro, für den teuersten hingegen 27,20 Euro. Wohnt man in München, könnte sich daher ein Ausflug nach Nürnberg lohnen. Den erschwinglichsten Tarif gibt es in der mittelfränkischen Großstadt für 13,50 Euro.
Dresden liegt im Mittelfeld des Preisvergleichs. In Sachsens Hauptstadt können Wellnessliebhaber ab 15,00 Euro saunieren. Leipzig hingegen ist die drittteuerste Stadt, wenn es um Saunapreise geht. Hier ist man mit 21,00 Euro dabei.
Das gesamte Ranking im Überblick*:
- Angaben in Euro -
- Karlsruhe: 7,00
- Berlin und Hannover: 8,50
- Bochum: 9,00
- Wuppertal: 10,00
- Stuttgart: 11,70
- Mannheim: 13,00
- Bielefeld und Nürnberg: 13,50
- Düsseldorf: 14,40
- Dresden: 15,00
- Bremen: 15,40
- München: 17,30
- Hamburg: 17,50
- Augsburg: 18,70
- Dortmund: 19,50
- Köln: 19,80
- Leipzig: 21,00
- Duisburg: 22,00
- Frankfurt am Main: 32,50
Den gesamten Preisvergleich sowie einen Sauna-Ratgeber finden Sie hier:
http://www.netzshopping.de/magazin-saunapreise-in-deutschland
*Sowohl Essen, Bonn und Münster müssen bei dem Preisvergleich außen vor bleiben, da es in diesen Großstädten entweder kein kommunal betriebenes Bad gibt beziehungsweise das Bad zwar öffentlich, die zugehörige Sauna jedoch privat betrieben wird.
*Die angegebenen Preise basieren auf folgenden Parametern:
- Tageskartenpreise (8 Stunden) für Erwachsene
- Wintersaison / Wochenende (Samstag und Sonntag)
- Familien- und Kindertickets sowie sonstige Vergünstigungen wurden nicht berücksichtigt
- Aufrufe: 365
 Thorsten Hoffmann, Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, besucht das Sprach- und Integrationsprogramm 4YOU der Stiftung help and hope und überzeugt sich selbst im Gespräch mit den jungen Geflüchteten von den Erfolgen des Programms. Mit dem eigenen Programm 4YOU möchte die Stiftung jungen Asylbewerbern in Dortmund die Integration erleichtern. Dazu werden praxisbezogene Sprachkurse und alltagspraktische Übungen durchgeführt. Momentan kommen 20 junge Erwachsene regelmäßig zu den Sprachkursen, die an vier Tagen unter der Woche stattfinden.
Thorsten Hoffmann, Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, besucht das Sprach- und Integrationsprogramm 4YOU der Stiftung help and hope und überzeugt sich selbst im Gespräch mit den jungen Geflüchteten von den Erfolgen des Programms. Mit dem eigenen Programm 4YOU möchte die Stiftung jungen Asylbewerbern in Dortmund die Integration erleichtern. Dazu werden praxisbezogene Sprachkurse und alltagspraktische Übungen durchgeführt. Momentan kommen 20 junge Erwachsene regelmäßig zu den Sprachkursen, die an vier Tagen unter der Woche stattfinden.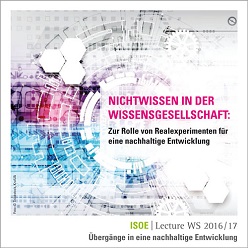 ISOE-Lecture im Wintersemester 2016/17 an der Goethe-Universität Frankfurt
ISOE-Lecture im Wintersemester 2016/17 an der Goethe-Universität Frankfurt