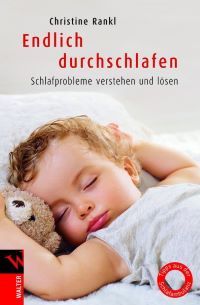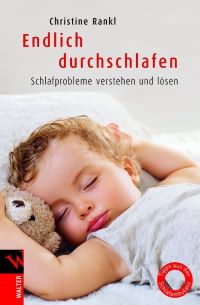Vorstellungen von Solidarität, Fürsorge und Verantwortung in den Erzählungen junger Grönländer
Für ein Projekt über Erinnerungen und Zukunftsvisionen haben junge
Kalaallit (grönländische Inuit) Erzählungen über ihre Gemeinschaft
verfasst. In einem Beitrag für die Fachzeitschrift „Études Inuit Studies“
beschreibt Projektleiterin Anne Chahine vom Forschungsinstitut für
Nachhaltigkeit (RIFS), welche gemeinsamen Wünsche in den Erzählungen und
ergänzenden Interviews mit den Autorinnen und Autoren zutage traten. Die
Praxis des Geschichtenerzählens, so ihre Schlussfolgerung, kann als
soziale Aktivität verstanden werden, die Konflikte schlichtet, Gräben in
der Gesellschaft überwindet und Ideen für das künftige Zusammenleben in
Kalaallit Nunaat (Grönland) entstehen lässt.
„Das Erzählen von Geschichten ist weder ein individuelles noch ein
geradliniges Unterfangen. Es ist tief mit unserem sozialen Umfeld verwoben
und trägt zum Aufbau von Beziehungen und zur Weitergabe von Wissen bei.
Die Erzählungen junger Kalaallit können uns daher helfen zu verstehen, wie
in Kalaallit Nunaat Beziehungen aufgebaut und Gemeinschaften geschaffen
werden“, sagt Chahine. Die Grundlage ihrer Publikation bilden die
„Zukunftserinnerungen“, die 28 Projekt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern
für nachfolgende Generationen entworfen haben. Diese wurden auf der
Website des Projektes „Future Memory Stories“ auf Englisch und Kalaallisut
veröffentlicht.
Bei ihrer Analyse der Texte legte Chahine den Schwerpunkt auf das
Geschichtenerzählen als soziale Aktivität. „Was mir an der allgemeinen
Absicht der geschriebenen Geschichten am meisten auffiel, waren die Gesten
der Solidarität gegenüber anderen Mitgliedern der Kalaallit-Gesellschaft
und eine klare Positionierung der Geschichtenerzählerinnen und -erzähler:
Sie stellten sich ihre jeweilige Rolle innerhalb ihrer Gesellschaft vor,
formulierten gemeinsame Werte, drückten Fürsorge aus und übernahmen
Verantwortung. Ich interpretiere das so, dass sie durch ihre Erzählpraxis
Konflikte lösen und Risse in der Gesellschaft kitten wollen, indem sie
sich einen zukünftigen Zustand der Beziehungen innerhalb der Kalaallit-
Gemeinschaft vorstellen, der von Natur aus enger ist. “ Das Streben nach
diesem Zustand der Nähe, der Handlung des „Sich-nahe-Kommens“, auf
Kalaallisut „qanilaarneq“, ziehe sich durch die Erzählungen.
„Du bist nicht allein“
Ein Beispiel für das Streben von Nähe und Verbundenheit ist die Erzählung
„I Want to Take Action – Iliuuseqarusuppunga“ („Ich will aktiv werden“).
Darin reflektiert Arnannguaq Autzen über ihre eigene Rolle in der sich
wandelnden Gesellschaft der Kalaallit. Sie stellt ihre Geschichte in den
Kontext der Danifikation in den 1950er und 1960er Jahren, die zu vielen
sozialen Problemen geführt habe. Autzen schreibt von ihrer Überzeugung,
dass Veränderungen jetzt möglich seien, und will selbst aktiv werden. Sie
wendet sich an ihre Landsleute mit einer klaren Botschaft: „Ich möchte die
Stimme sein, die den Menschen hilft, auf den richtigen Weg zu kommen.“ Als
Begleitung zum Textteil der Geschichte stellt Autzen ein Bild von sich
selbst als kleines Kind zur Verfügung, das die Hand seiner Großmutter
hält, und beschreibt es als Sinnbild ihrer eigenen Entwicklung, der
Fürsorge der älteren Generationen für die jüngeren. An die Leserschaft
gerichtet, schreibt die Autorin: „Ich möchte deine Hand nehmen und dir
zeigen, dass du nicht allein bist.“
Ein solcher Wunsch findet sich in mehreren Erzählungen. So schreibt die
Tätowiererin Paninnguaq Lind Jensen über die Probleme vieler Menschen in
Kalaallit Nunaat, angesichts der Kolonialgeschichte ihre Identität als
Dänen und Kalaallit zu finden. „Menschen nutzen Tätowierungen, um das
Chaos zu beseitigen, das dies in ihrer Seele angerichtet hat. Sie
beanspruchen ihre Identität als gemischte Person.“ Maannguaq Rosing hat
ihrer Erzählung mit dem Titel „Qanilaarneq” (Nähe) – der Begriff, den
Chahine als so prägend für die Wünsche junger Kalaallit sieht – ein Foto
beigefügt, auf dem sie sich zu ihrer Nichte beugt und ihr einen Kuss auf
den Kopf drückt – eine Art von Nähe, so Chahine, die eine Pause von allem
anderen erfordert, was die Aufmerksamkeit sonst noch in Anspruch nimmt,
eine Bereitschaft, sich ganz auf diesen Moment der Umarmung einzulassen.
Verständnisvoll, aber nicht konfliktscheu
„Meine ‚Zuhörpraktiken‘ basieren auf multimodalen Verknüpfungen, um
Verbindungen zwischen den Erzählenden und ihren beigesteuerten Multimedia-
Inhalten herzustellen. Beim Lesen dieser verschiedenen Modalitäten, also
der Arten der Darstellung, wird eine netzartige Struktur sichtbar, die von
tief verwurzelten Vorstellungen von Gemeinschaft geprägt ist“, erläutert
Chahine. Geschichten dienten als Mittel, um die Notwendigkeit und
Bereitschaft zur Überwindung drängender gesellschaftlicher Probleme zu
vermitteln, indem man sich selbst als Akteur des Wandels einbringt und
diese Konflikte aktiv vermittelt. So entstehe eine gemeinsame,
verständnisvolle Denkweise, eine Bereitschaft, oft ignorierte Probleme
anzugehen, und die Vorstellung einer Gemeinschaft, die mit einer Stimme
spricht, während sie gleichzeitig die Komplexität der kolonialen Gegenwart
anerkennt.
Der enge Austausch war Chahine auch bei ihrer eigenen Arbeit wichtig. So
teilte sie ihre Analyse der Erzählungen und erste Entwürfe ihres
akademischen Beitrags mit den Geschichtenerzählerinnen und -erzählern
sowie anderen Kalaallit-Beraterinnen und -Beratern und entwickelte ihren
Aufsatz auf der Basis dieser Gespräche weiter.
- Aufrufe: 14