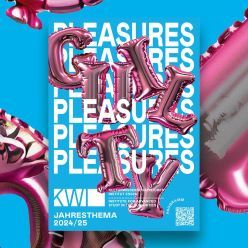TH Deggendorf eröffnet Bioengineering Lab

Im Beisein des bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kultur,
Markus Blume, wurde am 30. September in Oberschneiding das »Bioengineering
Transformation Lab« der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) feierlich
eingeweiht. In einem interdisziplinären Team der Bio-, Material- und
Ingenieurswissenschaften soll dort in den kommenden Jahren unter der
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Jeff Wilkesmann sowie der
Forschungs- und Laborleitung durch Dr. Richard Janissen geforscht und
entwickelt werden. Die Ziele sind dabei hoch gesteckt.
Prof. Peter Schmieder, Leiter des Bayerischen Innovations und
Transferzentrums (BITZ) in Oberschneiding und Mitbegründer des
Transformation Labs, will sich in Zukunft mit Innovationen alleine nicht
zufriedengeben. „Das Bioengineering hat enormes Potential, Produkte zu
entwickeln, die tatsächlich Märkte erfolgreich besetzen oder sogar aus den
Angeln heben können. Das ist es, was wir mit Transformation meinen. Wir
wollen an echten Game Changern forschen und auch an deren wirtschaftlicher
Verwertung.“ Heißt: High-End-Innovationen sollen im Transformation Lab
entwickelt, erstmals für die Umsetzung erprobt und schließlich zu
industrialisierungsfähigen Produkten standardisiert werden. Auch
Wissenschaftsminister Blume verwies in seinem Grußwort darauf, dass man
für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung zusätzlich auf neue
Industrien setzen müsse und sich nicht immer nur auf diejenigen verlassen
könne, die es seit 100 oder 150 Jahre gebe.
Seit seinem Amtsantritt im Februar 2022 sei Blume ein Bewunderer der
Tatkraft der THD geworden und bezeichnete das BITZ bei der Veranstaltung
am Montag als „unser niederbayerisches Tor zum Silicon Valley.“ Der
Minister weiter: „Das Bayerische Innovationstransferzentrum BITZ in
Oberschneiding ist eine echte Erfolgsgeschichte. Die TH Deggendorf als
Erfinderin unserer Technologietransferzentren macht hier im Landkreis
Straubing-Bogen vor, wie’s geht: Sie bringt Talente und Technologie
zusammen und setzt starke Impulse für neue Industrien. Das alles mit Know-
how und in enger Kooperation mit Partnern aus dem Silicon Valley. Der neue
Fokus liegt nun auf Bioengineering – einem entscheidenden Zukunftsfeld!“
Letzteres hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es der THD gelungen
ist, „mit Jeff Wilkesmann und Richard Janissen zwei international absolut
renommierte Wissenschaftler für diese Bioengineering-Mission an den
Standort Oberschneiding zu locken“, wie THD-Präsident Prof. Waldemar Berg
bestätigt. Das Transformation Lab am Standort des BITZ Oberschneiding
werde im Rahmen der Hightech Agenda Bayern und der Hightech Transfer
Bayern-Initiative mit Personal- und Sachmitteln in Höhe von insgesamt bis
zu knapp drei Millionen Euro über eine Laufzeit von fünf Jahren gefördert.
Wenn alles läuft wie geplant, wird Staatsminister Blume seinem
abschließenden Versprechen sicherlich mit Freude Folge leisten: „Ich komme
gerne wieder nach Oberschneiding.“ Einen besonderen Dank richtete der
Minister dabei auch an MdL Josef Zellmeier und Oberschneidings
Bürgermeister Ewald Seifert für ihren unermüdlichen Einsatz für das BITZ.
- Aufrufe: 47