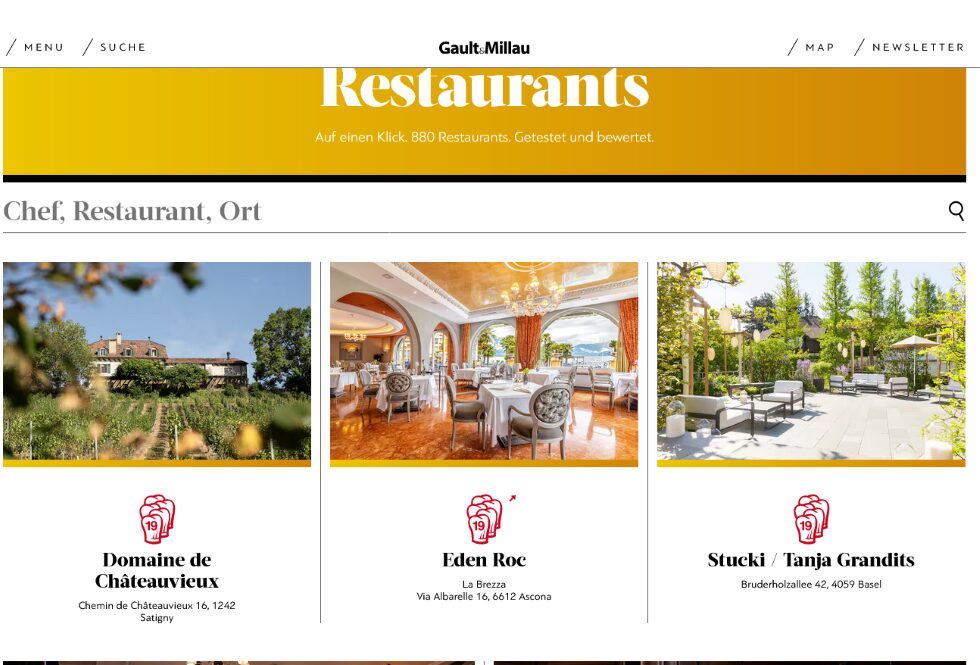Faire und transparente KI: Niki Kilbertus spricht zur Herbstveranstaltung von Leopoldina und Leopoldina Freundeskreis
Maschinelle Lernsysteme spielen in immer mehr Lebensbereichen eine
wichtige Rolle, etwa in der medizinischen Diagnostik, bei Chatbots oder
personalisierten Vorschlägen von Streaming-Anbietern. Wenn maschinelle
Lernsysteme jedoch an sensiblen Stellen über Menschen entscheiden –
beispielsweise bei Vorstellungsgesprächen oder beim Prüfen der
Kreditwürdigkeit – müssen Fairness und Transparenz sichergestellt werden.
Darüber spricht Prof. Dr. Niki Kilbertus in seinem Vortrag „Fairness in
maschinellem Lernen” bei der gemeinsamen Herbstveranstaltung der
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und des Leopoldina
Akademie Freundeskreises e.V. am Donnerstag, 24. Oktober in Halle (Saale).
Kilbertus gehört zu den Pionieren der ethischen maschinellen Lernsysteme
und wird im Rahmen der Herbstveranstaltung für seine Forschungsleistungen
mit dem Leopoldina-Preis für junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler 2024 geehrt.
Gemeinsame Herbstveranstaltung der Leopoldina und des Leopoldina Akademie
Freundeskreises e.V.
Mit der Verleihung des Leopoldina-Preises für junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler 2024 und dem Vortrag „Fairness in maschinellem Lernen”
des Preisträgers Prof. Dr. Niki Kilbertus
Donnerstag, 24. Oktober 2024, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Vortragssaal der Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)
Niki Kilbertus ist seit 2021 Professor für Ethics in Systems Design and
Machine Learning an der Technischen Universität München im Fachbereich
Informatik und seit 2020 Forschungsgruppenleiter bei Helmholtz AI am
Helmholtz Zentrum München. Ihm gelang es, kausale Konzepte der Fairness
bei automatisierten Entscheidungsprozessen zu formalisieren. Um
Entscheidungen treffen zu können, müssen maschinelle Lernsysteme mit Daten
trainiert werden, die sie zueinander in Beziehung setzen. Kilbertus legt
in seiner Forschung einen besonderen Schwerpunkt auf die Ursache-Wirkungs-
Beziehungen aus Beobachtungsdaten, die kausalen Inferenzen. Diese zielen
darauf ab, echte kausale Zusammenhänge von bloßen Korrelationen in Daten
zu unterscheiden. Bei der Weiterentwicklung des Systems sollen die
maschinellen Lernsysteme in die Lage versetzt werden, sich von
fehlerhaften Annahmen zu lösen und so angemessene Entscheidungen zu
treffen. Die Forschung dient der Entwicklung von hochpräzisen, ethisch
vertretbaren und vertrauenswürdigen KI-Systemen. Bei der
Herbstveranstaltung widmet sich Niki Kilbertus in seinem Vortrag der Rolle
von Methoden des maschinellen Lernens in Fragen der sozialen Gerechtigkeit
und Diskriminierung.
Weitere Informationen zum Leopoldina-Preis für junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler 2024:
https://www.leopoldina.org/pre
Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist
frei. Zum Link zur erforderlichen Anmeldung sowie zu weiteren
Informationen:
https://www.leopoldina.org/ver
Journalistinnen und Journalisten, die an der Veranstaltung teilnehmen
möchten, melden sich bitte per E-Mail unter
Seit 1993 vergibt die Akademie den Leopoldina-Preis für junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er wird jährlich an junge
Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mit bemerkenswerten
wissenschaftlichen Leistungen vergeben, deren Promotion nicht mehr als 5
Jahre zurückliegt. Der Auswahlkreis ist übernational. Der Preis ist seit
2019 mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird durch den
Leopoldina Akademie Freundeskreis finanziert. Informationen zum Leopoldina
Akademie Freundeskreis: https://www.freundeskreis-leop
Die Leopoldina auf X: http://www.twitter.com/leopold
Die Leopoldina auf YouTube:
https://www.youtube.com/@natio
Über die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina:
Als Nationale Akademie der Wissenschaften leistet die Leopoldina
unabhängige wissenschaftsbasierte Politikberatung zu gesellschaftlich
relevanten Fragen. Dazu erarbeitet die Akademie interdisziplinäre
Stellungnahmen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. In
diesen Veröffentlichungen werden Handlungsoptionen aufgezeigt, zu
entscheiden ist Aufgabe der demokratisch legitimierten Politik. Die
Expertinnen und Experten, die Stellungnahmen verfassen, arbeiten
ehrenamtlich und ergebnisoffen. Die Leopoldina vertritt die deutsche
Wissenschaft in internationalen Gremien, unter anderem bei der
wissenschaftsbasierten Beratung der jährlichen G7- und G20-Gipfel. Sie hat
rund 1.700 Mitglieder aus mehr als 30 Ländern und vereinigt Expertise aus
nahezu allen Forschungsbereichen. Sie wurde 1652 gegründet und 2008 zur
Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. Die
Leopoldina ist als unabhängige Wissenschaftsakademie dem Gemeinwohl
verpflichtet.
- Aufrufe: 9