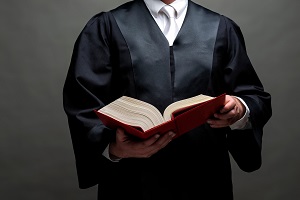Schüler:innen des Romain-Rolland-Gymnasiums Dresden zu Gast an der ehs: Rückblick auf ein erfolgreiches Format
Am Montag, den 12. Dezember 2022, fand an der Evangelischen Hochschule
Dresden (ehs) erstmalig eine deutsch-tschechische Schüleruni statt.
Schülerinnen und Schüler des Romain-Rolland-Gymnasiums Dresden besuchten
gemeinsam mit ihren tschechischen Austauschschüler:innen aus Teplice die
ehs, um einen Einblick in sozialwissenschaftliche Forschung mit Kindern
und Jugendlichen zu bekommen.
Prof. Dr. Nina Weimann-Sandig, Professorin für Soziologie und Empirische
Sozialforschung sowie Hochschuldidaktische Beauftragte der ehs, und Frau
Susann Rüthrich, Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Sachsen,
begrüßten im kleinen Hörsaal der ehs rund 40 deutsche und tschechische
Schüler:innen. Die Veranstaltung fand im Rahmen des deutsch-tschechischen
Austauschs des Romain-Rolland-Gymnasiums Dresden mit dem Gymnasium in
Teplice statt. Der diesjährige Austausch stand unter dem Motto „Jugend und
Schule – Lernen aus Corona“. Dazu stellten die beiden Projekte KonFa und
BediRa ihre Arbeit bzw. ihre Ergebnisse vor. Das Projekt KonFa –
„Entwicklung familiärer Konflikte in Zeiten von Corona – Fokus Sachsen“ –
untersuchte unter der Leitung von Prof. Weimann-Sandig bis zum Sommer 2022
sachsenweit mit online-Befragungen von Eltern, Kindern und Jugendlichen,
wie es Familien in Sachsen während der Corona-Pandemie ging. Die
Forschungsdaten wurden untermauert durch Schülerpitches, Videos sowie die
Analyse von Tagebucheinträgen, durch welche die Schüler:innen ihre
Erfahrungen mit Homeschooling, Kontaktverboten und Konflikten in den
Familien mit anwesenden Expert:innen auf sehr eindrucksvolle und
reflektierte Art teilten.
Das Projekt BediRa – „Beziehungsarbeit im digitalen Raum – reflexive
Professionalität durch ein Konzept für digitale Lehre fördern“ –
entwickelt ebenfalls unter der Leitung von Professorin Weimann-Sandig ein
zukunftsweisendes Konzept für die digitale Lehre, das die Spezifika von
Hochschulen mit sozialen, pflegerischen und personenbezogenen
Studiengängen in den Mittelpunkt stellt und somit einen Schwerpunkt auf
Beziehungsarbeit im digitalen Raum setzt. Dabei werden Studierende sowie
Lehrende aus möglichst allen Studienbereichen in die Konzeptentwicklung
eingebunden, um die Bedarfe aller Zielgruppen an der Hochschule abbilden
zu können.
Durch beide Projekte erhielten die Schüler:innen einen ersten Einblick in
sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden- und Fragestellungen.