Rätselhafte Spuren in Röntgens Labor
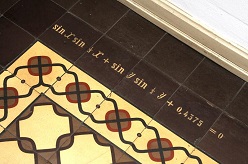 Ein Tourist aus Australien entdeckt auf dem Fußboden der Röntgen-
Ein Tourist aus Australien entdeckt auf dem Fußboden der Röntgen-
Gedächtnisstätte – dem ehemaligen Physikalischen Institut der Universität
Würzburg – seltsame mathematische Formeln, die er sich nicht erklären
kann. Des Rätsels Lösung findet er erst nach einer internationalen Suche.
Tony Bracken ist emeritierter Professor für Mathematik der University of
Queensland (Australien). So ist es nicht verwunderlich, dass eine seltsame
Beobachtung bei seinem jüngsten Besuch als Tourist in Würzburg seine
Neugierde weckte: „In der Röntgen-Gedächtnisstätte am Röntgenring fielen
mir zwei seltsame trigonometrische Formeln auf, die am westlichen Eingang
des Gebäudes in den Boden eingraviert waren“, schreibt Bracken.
Unsinn oder Forschung?
Ihre Bedeutung konnte sich der Mathematiker nicht erklären. „Für mich
sahen sie nach Unsinn aus. Aber vielleicht haben sie ja eine Bedeutung im
Zusammenhang mit der Forschung, die damals in dem Gebäude betrieben
wurde“, sagt Bracken.
sin (y)sin (y/2)=1.3685 sin (x)sin (x/3) und sin (x)sin (x/3)+sin (y)sin
(y/3)+0.4375=0: So lauten die beiden Formeln in den Bodenkacheln. Auf der
Suche nach einer Lösung für dies Rätsel wandte sich Bracken an die
Pressestelle der Universität Würzburg. Dort konnte man ihm allerdings
nicht weiterhelfen.
Licht in das Dunkel sollte erst ein Brief bringen, den Tony Bracken in
Physics World, der Zeitschrift des British Institute of Physics,
veröffentlichte, in dem er die Formeln wiedergab. „Mich hat daraufhin ein
englischer Physiker im Ruhestand kontaktiert, der seinerseits Kollegen in
Deutschland befragt hatte“, schreibt Bracken.
Und tatsächlich: Einer dieser deutschen Kollegen hatte die Frage an die
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg weitergeleitet, in
deren Besitz sich heute das Gebäude am Röntgenring befindet. Von dort
erhielt er einen Zeitungsartikel, der 1971 in der Main-Post erschienen war
und der sich mit den seltsamen Formeln beschäftigte. Eine eingescannte
Version dieses Artikels lag der Post an Bracken bei.
Ein Artikel der Main-Post hilft weiter
Unter der Überschrift „sin x und sin y unter den Füßen“ hatte sich der
Autor Ernst Nöth am 2. Juli 1971 mit der Bedeutung der Formeln
beschäftigt. Das Ergebnis: Die mathematischen Formeln bilden die Grundlage
für das Muster der Bodenfliesen, die in dem Gebäude zu sehen sind. Zum
Beweis zitiert Nöth aus einer handschriftlichen Chronik von Professor
Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910), der von 1875 bis 1888 als
Vorgänger von Wilhelm Conrad Röntgen Ordinarius für Physik an der
Universität Würzburg gewesen war.
„Die Fußbodenplattung am Eingang wurde nach Zeichnungen des Assistenten
Dr. Strouhal aus Gefälligkeit von Villeroy und Boch in Mettlach unter
Leitung des Ingenieurs Hrn. Urbach hergestellt. Die Curven fanden sich in
einer amerikanischen Abhandlung von Newton und Philipps“, heißt es in
dieser Chronik.
Der historische Hintergrund
Vinzenz Strouhal, auf den die Zeichnung der Bodenplatten also zurückgeht,
stammte aus Prag und war von 1875 bis 1879 wissenschaftlicher Assistent
bei Kohlrausch und anschließend Privatdozent. 1882 kehrte er nach Prag
zurück – als einer der Gründungsprofessoren im Bereich Physik an der
Karls-Universität. Dort absolvierte er eine „herausragende Karriere“, wie
Tony Bracken schreibt. Vor allem seine Forschung auf dem Gebiet der Physik
von Flüssigkeiten sei von großer Bedeutung gewesen. Die Strouhal-Zahl –
eine in der Strömungsmechanik verwendete dimensionslose Kennzahl – ist
nach ihm benannt.
1875 hatte Friedrich Kohlrausch die ersten Pläne für das Physikalische
Institut am späteren Röntgenring gezeichnet. Es sollten allerdings drei
Jahre vergehen, bis der Landtag den Bau bewilligte. Am 18. Mai 1878 wurde
mit dem Bau begonnen, am 8. November 1879 wurde das Institut eröffnet.
Exakt 16 Jahre später – am 8. November 1895 – sollte Wilhelm Conrad
Röntgen dort die Entdeckung machen, die noch heute mit seinem Namen
verbunden ist.
Formeln bilden das Fliesenmuster
Damit ist also klar, dass die Formeln nichts mit Röntgens Forschung zu tun
haben. Und die Suche nach der „amerikanischen Abhandlung von Newton und
Philipps“, aus der sie stammen sollen, wurde bisher noch nicht gestartet.
Immerhin konnte Anja Schlömerkemper, Inhaberin des Lehrstuhls für
Mathematik in den Naturwissenschaften an der Uni Würzburg, bestätigen,
dass die Formeln tatsächlich für das Fliesenmuster im Eingangsbereich des
einstigen Physikalischen Instituts stehen.
Mit Hilfe des Programms Mathematica konnte die Professorin die Kurven
anhand der Formeln graphisch darstellen: „Die Formel, in der 0.4375
vorkommt, entspricht dem Ornament auf den äußeren Fliesen; die andere
Formel, also die mit 1.3685, entspricht dem Muster auf den inneren
Fliesen“, erklärt Schlömerkemper.
Und was bleibt nun als Fazit? Zumindest die Aussage, dass die Spuren im
Boden der Röntgen-Gedächtnisstätte Beweis dafür sind, „dass mathematische
Formeln Generationen, Regierungen, Kriege und Brände unbeschädigt
überstehen, selbst wenn sie von Studenten, Assistenten und Professoren
viele Jahrzehnte mit Füßen getreten werden“, wie Ernst Nöth 1971 in der
Main-Post schreibt. Und heute sogar von den Füßen aufmerksamer Touristen
aus Australien.
- Aufrufe: 182