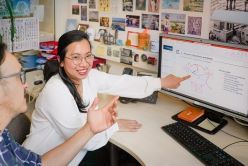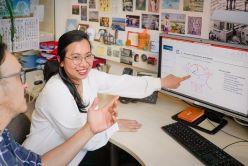TU Clausthal sorgt für LoRaWAN-Netzabdeckung im Oberharz

Auf Gebäuden der Universität sind Zugangspunkte für ein LoRaWAN-Netz in
Betrieb gegangen. Im Umkreis von mehreren Kilometern um Clausthal-
Zellerfeld kann nun jeder Sensor-Messwerte live ins Internet übertragen.
Die Digitalisierung im Oberharz schreitet voran: Auf drei Gebäuden der
Technischen Universität Clausthal wurden Zugangspunkte, so genannte
Gateways, für das drahtlose LoRaWAN-Netzwerk installiert und an die
weltweit genutzte Plattform für das Internet der Dinge (The Things
Network, TTN) angebunden. Die Gateways sind für alle Interessierten
kostenlos ohne Beschränkung zugänglich und ermöglichen ein breites
Spektrum an Anwendungen. Unternehmen wie auch Privatpersonen können
drahtlose LoRaWAN-Sensorsysteme in und um die Berg- und Universitätsstadt
ausbringen. Über die installierten Zugangspunkte können diese ihre Daten
ins Internet übertragen, wo sie angezeigt und ausgewertet werden können.
LoRaWAN: Drahtloses Weitbereichsnetz mit hoher Reichweite und niedrigem
Energiebedarf
Die LoRaWAN-Architektur wurde speziell für das Internet der Dinge
entworfen, um über Distanzen von mehreren Kilometern kommunizieren zu
können. Heute kommt die Technologie bereits unter anderem bei Stadtwerken,
Energieversorgern und Verkehrsinfrastrukturbetreiber
Messdaten an relevanten Standorten erfassen und bereitstellen zu können.
Auch Privatpersonen nutzen zunehmend die LoRaWAN-Technologie, etwa bei
drahtlosen Wetterstationen. Das Kommunikationsprotokoll ist dabei
besonders energiesparend, so dass im Batteriebetrieb Sensorlaufzeiten von
bis zu zehn Jahren möglich sind.
Spannende Einsatzgebiete in Forschung und Lehre
Der Aufbau des LoRaWAN-Netzwerks spielt in der Forschung ebenfalls eine
große Rolle. So werden etwa an der TU Clausthal Ausbreitungsmodelle für
dieses Funksystem entwickelt. „Der Standort bietet ideale Bedingungen:
Sowohl die Einflüsse von Gebäuden in Clausthal-Zellerfeld als auch die für
Funk anspruchsvolle Mittelgebirgs-Topografie kann mit diesem Netz
untersucht werden. Hinzu kommen die vielfältigen Witterungsbedingungen im
Oberharz“, erklärt Prof. Niels Neumann, der an Kommunikationstechnik für
das Internet der Dinge forscht. Damit eine zuverlässige Kommunikation auch
bei Wind und Wetter möglich ist, arbeitet ein weiteres Team um den
Informatikprofessor Andreas Reinhardt an neuartigen Verfahren. Mit deren
Hilfe können die LoRaWAN-Empfänger selbständig erkennen, wenn
witterungsbedingte Datenverluste zu erwarten sind. „Die Datenübertragung
über ein LoRaWAN-Netz ist an sich sehr robust, aber unter extremen
Wetterbedingungen immer noch störanfällig. Wir entwickeln Verfahren, damit
auch bei extremen Niederschlägen oder Schneefall alle Messdaten ankommen“,
so der Clausthaler Forscher.
Auch Prof. Jens-André Paffenholz sieht ein enormes Potenzial im Einsatz
des Netzwerks. Er forscht mit seinem Team an der Erfassung von
Umweltparametern, etwa der Bodenfeuchte, um mit vergleichsweise günstigen
Sensoren massenhaft Daten zu erfassen. Für ihn ist der klare Vorteil der
drahtlosen Technologie die Echtzeitverfügbarkeit der Sensordaten, so dass
ein manuelles Auslesen bei großen Geosensornetzen entfällt und
gleichzeitig eine Echtzeitauswertung der Daten ermöglicht wird. Die
Nutzung kostengünstiger Sensoren wirft hierbei die Frage nach der
Datenqualität der erfassten Umweltparameter auf. Genau hier setzt der
Forschungsansatz des Teams von Prof. Paffenholz an, das sich der
Forschungsfrage „Wie können aus großen Datenmengen, auch als ‚Big Data‘
bekannt, durch eine intelligente Auswertung zuverlässige Informationen
abgeleitet werden?“ widmet. Auch in der Lehre werden die Sensorknoten
eingesetzt, etwa zur experimentellen Bestimmung der Funkabdeckung. So
bringt diese Technologie die Studierenden hinaus in die Natur.
Großes Potenzial für die Region
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Installation des LoRaWAN-Netzes den
Oberharz fit für die Zukunft machen. Dieses Netzwerk bietet enorme
Möglichkeiten für die Region. Wir hoffen, dass viele Unternehmen und
Privatpersonen den ermöglichten Datenzugang nutzen und damit neue Produkte
und Dienstleistungen anbieten“, sind sich die Professoren Reinhardt,
Neumann und Paffenholz einig. Das Trio leitet die Initiative, die damit
auch auf das Thema Citizen Science abzielt, gemeinsam an der TU Clausthal.
Der dauerhafte Betrieb der Gateways wird vom Team des TU-Rechenzentrums
gewährleistet. Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des Forschungspools
der Universität.
Mitmachen
Wie kann ich nun aktiv werden? Im Internet finden sich hierzu viele
Bastelanleitungen, zum Beispiel unter https://www.instructables.com
/LoRaWan-Weather-Station/. Mit der Initiative Smart Harz, mit dem Slogan
„Wir vernetzen den Harz“, besteht bereits ein reger Austausch zur
Zusammenarbeit.
Kontakt:
TU Clausthal
Presse, Kommunikation und Marketing
E-Mail: <
- Aufrufe: 31