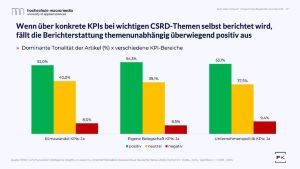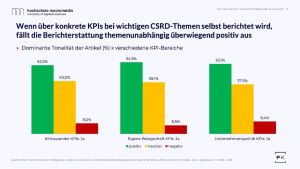Mehrheit der Arbeitnehmer*innen unterstützt Energiewende, will aber stärkere Bindung an soziale Kriterien
Neue Befragung
Mehrheit der Arbeitnehmer*innen unterstützt Energiewende, will aber
stärkere Bindung an soziale Kriterien – AfD-Wählende unterscheiden sich
grundlegend
Eine Mehrheit der Arbeitnehmer*innen in Deutschland unterstützt die
Energiewende, also den Ausbau der erneuerbaren Energien und den
Kohleausstieg. Sorgen bereiten die möglichen wirtschaftlichen und
arbeitsmarktpolitischen Folgen, zudem hält nur rund ein Drittel der
Beschäftigten die aktuellen Ziele für den Ausbau Erneuerbarer für
realistisch, ein Drittel ist unentschieden, ein Drittel findet sie
unrealistisch. Generell gibt es deutliche Unterschiede entlang der
parteipolitischen Präferenzen: Die Anhängerschaft der AfD unterscheidet
sich in ihren Ansichten grundlegend von den Wähler*innen der
demokratischen Parteien und steht der Energiewende überwiegend kritisch
gegenüber. Auch die BSW-Wählerschaft hat teils eigene Auffassungen, wenn
auch nicht so stark abweichend wie diejenige der AfD. Unabhängig von der
politischen Präferenz ist eine deutliche Mehrheit der Arbeitnehmer*innen
in Deutschland dafür, die staatliche Förderung und Gestaltung der
Energiewende an klare soziale Kriterien und gute Arbeitsbedingungen zu
binden, wozu Tarifverträge und Mitbestimmung zählen. Das zeigt eine neue
Studie von Prof. Dr. Vera Trappmann und Dr. Felix Schulz von der
Universität im britischen Leeds. Die von der Hans-Böckler-Stiftung
geförderte Studie basiert auf Daten einer repräsentativen Befragung von
rund 2000 abhängig Beschäftigten in Deutschland.*
Eine Mehrheit der im April und Mai 2024 Befragten, nämlich 59 Prozent,
stimmt zu, dass die Energiewende unabdingbar ist, um die Klimaziele zu
erreichen. 25 Prozent sind unentschieden. Und 16 Prozent der Befragten
halten sie nicht für zwingend notwendig. „Ein erheblicher Anteil von vier
Zehnteln ist also nicht von der Notwendigkeit der Energiewende zur
Erreichung der nationalen Klimaziele überzeugt“, so Schulz und Trappmann
(detaillierte Grafiken zu allen Fragen in der Studie; Link unten).
Die größte Zustimmung findet eindeutig die Solarenergie: 61 Prozent der
Befragten sind der Meinung, dass Deutschland einen großen oder sehr großen
Anteil seiner Energie aus der Sonne beziehen sollte. Bei Windkraft sagen
das 52 Prozent und bei Biomasse 34 Prozent. 23 Prozent der Befragten
sprechen sich für einen hohen bis sehr hohen Anteil von Erdgas aus. Knappe
Mehrheiten stehen hinter dem Ziel, zwei Prozent der Fläche Deutschlands
für Windenergie auszuweisen. Gleiches gilt für einen weitgehenden
Kohleausstieg.
Gleichzeitig ist jeweils eine knappe Mehrheit der Meinung, dass die
Kernenergie und einige Kohlekraftwerke auch in Zukunft als
Übergangsenergiequellen für die Industrie benötigt werden. Ein immer
wieder genannter Grund dafür ist die Angst vor Versorgungsengpässen und
Preissteigerungen: 37 Prozent aller Befragter befürchten eine geringere
Versorgungssicherheit, 42 Prozent rechnen nicht mit sinkenden Preisen im
Zuge der Energiewende. Bei beiden Aussagen zeigen sich zudem rund 30
Prozent unentschieden. Nur eine Minderheit ist mit Technologien wie
Wasserstoff, der als elementarer Baustein für die Transformation
energieintensiver Industrien gilt, und CO₂-Speicherung vertraut.
„Wir sehen deutlich eine große Unsicherheit mit Blick auf die Folgen der
Energiewende auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Christina Schildmann, Leiterin
der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Bestes
Beispiel: Bei der Aussage ‚Die Jobs in den Branchen der erneuerbaren
Energien werden gut bezahlt sein‘ antworten fast 50 Prozent mit ‚Ich
stimme weder zu noch lehne ich ab‘. Das zeigt, wie groß die Fragezeichen
in den Köpfen der Beschäftigten zu den sozialen und
arbeitsmarktpolitischen Folgen der Energiewende sind.“
-Wähler*innen von AfD und BSW antworten deutlich anders-
Entlang des parteipolitischen Spektrums zeichnen sich klare Trends ab:
Generell befürworten die Anhänger*innen der etablierten demokratischen
Parteien die Energiewende stärker und liegen in fast allen Fragen näher
beieinander. Aber sie lassen sich noch einmal in zwei Lager einteilen: Die
Anhängerschaft der Grünen, der SPD und der Linken unterstützt die
Energiewende stärker und konsequenter als die der Union und der FDP. Wenig
überraschend stimmen 93 Prozent der Anhänger*innen der Grünen der Aussage
zu, dass die Energiewende unverzichtbar ist, um die nationalen Klimaziele
zu erreichen. Bei der Linken liegt die Zustimmung bei 90 Prozent und bei
der SPD bei 83 Prozent. Jeweils 67 Prozent der Beschäftigten, die CDU/CSU
oder FDP wählen würden, stimmen der Aussage zu, dass die Energiewende
unabdingbar ist.
Die Anhängerschaft der AfD hebt sich mit deutlich geringeren
Zustimmungswerten von den anderen ab. Hier halten nur 24 Prozent die
Energiewende für unverzichtbar. Allerdings, so betonen Trappmann und
Schulz, gebe es in dieser Gruppe noch viele Unentschlossene. Nicht
eindeutig zu verorten sind die Anhänger*innen des BSW. Mit 41 Prozent
stimmen sie der Energiewende seltener zu als die der etablierten
demokratischen Parteien, aber häufiger als die der AfD.
Bei den Wähler*innen von AfD und BSW ist die Angst vor Preissteigerungen
und Arbeitsplatzverlusten überdurchschnittlich ausgeprägt. Stark steigende
Preise nach dem Kohleausstieg befürchten beispielsweise 71 Prozent der
AfD-Anhänger*innen, beim BSW sind es 57 Prozent. Arbeitsplatzverluste
erwarten 70 beziehungsweise 63 Prozent. Bei der Wählerschaft der anderen
Parteien erwartet nur eine Minderheit, dass die Preise stark steigen
werden, wobei allerdings unter Wähler*innen von SPD, FDP und Union ein
gutes Drittel bis knapp 50 Prozent damit rechnet. Ähnlich ist das Muster
bei der Frage nach Jobverlusten durch den Kohleausstieg.
-Neben wirtschaftlichen auch ideologische Gründe für Ablehnung-
Was sind die Gründe für die unterschiedlichen Einstellungen? Man könnte
vermuten, dass die Sympathisant*innen von AfD und BSW mehr Angst vor
Preissteigerungen und Arbeitsplatzverlust haben, weil sie im Durchschnitt
über ein geringeres Einkommen und einen niedrigeren Bildungsabschluss
verfügen. Die Wissenschaftlerin und der Wissenschaftler können jedoch
zeigen, dass die signifikanten Unterschiede auch nach Kontrolle von
soziodemografischen Merkmalen wie Einkommen, Bildung und Bundesland
bestehen bleiben. Das bedeutet: Die Anhängerschaft der AfD und des BSW hat
zwar mehr Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Energiewende. Dies ist
aber nicht ausschließlich auf eine schlechtere wirtschaftliche Situation
im Vergleich zu den Wähler*innen der anderen Parteien zurückzuführen.
Neben sozioökonomischen Aspekten spielten offenbar auch ideologische
Aspekte eine Rolle, erklären die Forschenden. Sie verweisen auf frühere
Studien, nach denen AfD-Wähler*innen generell häufiger Zweifel an der
Existenz des menschengemachten Klimawandels haben. Diese Einstellung sei
bei vielen bereits vor dem Wechsel ins Lager der AfD vorhanden gewesen.
-Unabhängig von Parteipräferenzen will deutliche Mehrheit klare Bindung an
soziale Kriterien und gute Arbeitsbedingungen-
Es gibt aber auch Mehrheiten über Parteigrenzen hinweg: Die
Anhängerschaften aller Parteien, auch die der AfD und des BSW, sprechen
sich laut Studie mehrheitlich dafür aus, staatliche Subventionen an
soziale Aspekte und gute Arbeitsbedingungen zu knüpfen – eine Idee, für
die sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften stark gemacht haben.
Insgesamt stimmen 68 Prozent dem Vorschlag zu, 26 Prozent sind
unentschieden und nur sechs Prozent sind dagegen.
Zudem stimmt eine Mehrheit von insgesamt 67 Prozent zu, dass die
Energiewende erfolgreicher wird, wenn Bürgerinnen und Bürger sowie
Beschäftigte mitbestimmen können. Am größten ist die Zustimmung bei
Anhänger*innen der Linken mit 71 Prozent und des BSW mit 67 Prozent. Es
folgen die SPD mit 64 Prozent, die Union mit 60 Prozent, die Grünen mit 57
Prozent, die FDP mit 54 Prozent und die AfD mit 52 Prozent.
„Insgesamt legen die Ergebnisse unserer Studie nahe, dass die Forderungen,
die ökologische Transformation sozial zu gestalten, nicht nur eine Fußnote
in der politischen Diskussion ausmachen können, sondern zentral werden
müssen, um den Zuspruch zu demokratischen Parteien der Mitte
aufrechtzuerhalten und wieder zu stärken“, schreiben Schulz und Trappmann.
Sie leiten daraus vier zentrale Handlungsempfehlungen ab:
1. Förderung an soziale Bedingungen knüpfen. Staatliche Investitionen
sollten an Kriterien guter Arbeit wie Tariflöhne und Betriebsräte geknüpft
werden. Vor allem in den neu entstehenden Branchen sollten mehr
Tarifverträge abgeschlossen werden. Hier müsse auch die Bundesregierung
aktiver werden und mehr Druck auf die Unternehmen ausüben, um die
Tarifbindung in der Branche der erneuerbaren Energien zu erhöhen.
2. Energiewende braucht Mitbestimmung. Neben der demokratischen Teilhabe
sollten die Bürgerinnen und Bürger auch an den finanziellen Vorteilen der
erneuerbaren Energien, zum Beispiel Windparks, beteiligt werden. Dies kann
die Akzeptanz von Projekten in der Region erhöhen. Dazu sollte die bereits
bestehende politische Unterstützung für „Bürgerwindparks“ und ähnliche
Beteiligungskonzepte ausgebaut werden.
3. Haushalte finanziell entlasten. Allein auf marktwirtschaftliche
Maßnahmen zu setzen, wird nicht funktionieren. So belasten zum Beispiel
marktbasierte CO₂-Preise die unteren und mittleren Einkommensgruppen
überproportional. Um einen Ausgleich zu schaffen, könnten zum einen
Senkungen der Steuern auf Lebensmittel mit günstiger CO₂-Bilanz und den
öffentlichen Verkehr das allgemeine Preisniveau senken und so die
Haushalte entlasten. Zum anderen müssen durch eine Reform der
Schuldenbremse mehr öffentliche Mittel für die Dekarbonisierung der
Infrastruktur bereitgestellt werden. Das würde Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit geben, CO₂-Emissionen zu vermeiden und damit Geld zu sparen,
etwa durch leistungsfähigen und günstigen öffentlichen Nahverkehr. Ebenso
muss die Bundesregierung ihr Versprechen für mehr bezahlbaren,
energieeffizienten und emissionsarmen sozialen Wohnungsbau einlösen.
4. Vertrauen in Energiesicherheit schaffen. Die Bundesnetzagentur hat
versichert, dass die Energieversorgung auch nach dem Kohle- und
Atomausstieg gesichert ist. In der Bevölkerung ist dies jedoch noch nicht
angekommen – es herrscht große Verunsicherung, die den Rückhalt für die
Energiewende schmälert. Die Forschenden empfehlen daher
Informationskampagnen.
- Aufrufe: 11