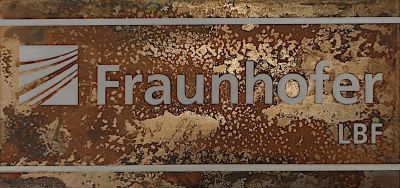Nachhaltige Salzpaste revolutioniert die Korrosionsprüfung
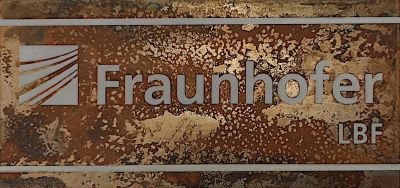
Korrosion ist ein alltäglicher Prozess, der die Lebensdauer von
Materialien erheblich beeinflusst. Er beeinträchtigt die Stabilität und
die Eigenschaften von Metallerzeugnissen und stellt eine große
Herausforderung in verschiedenen Industrien dar. Eine gründliche Prüfung
von Bauteilen ist unerlässlich, um die Produktlebensdauer und
Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen im Vorfeld zu bewerten.
Forschende aus dem Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und
Systemzuverlässigkeit LBF haben eine neue Salzpaste kreiert. Sie kann für
diverse Testszenarien individuell angepasst werden und liefert
vergleichbare Ergebnisse wie der traditionelle Salzsprühtest, der einige
Nachteile mit sich bringt
Umweltsimulation als Schlüssel zur Langlebigkeit
Gezielte Korrosionstests unter mechanischer Beanspruchung geben
Rückschlüsse auf die Lebensdauer von Bauteilen. Die Analyse der Ergebnisse
hilft, die Lebensdauer von Produkten zu verbessern. Salznebeltests, die in
kontrollierten Umgebungen durchgeführt werden, simulieren die Auswirkungen
von salzhaltiger Luft auf Materialien. Diese Tests sind besonders in der
Automobil- und Luftfahrtindustrie von entscheidender Bedeutung, um die
Korrosionsbeständigkeit zu bewerten. Dabei werden die Produkte in eine
Kammer gelegt, in der eine salzhaltige Lösung als Nebel versprüht wird, um
beschleunigte Korrosionsbedingungen zu erzeugen. Die Ergebnisse dieser
Tests unter realen Bedingungen sind entscheidend für die Vorhersage der
Produktlebensdauer und Zuverlässigkeit. Allerdings erfordern diese Tests
große Mengen an Salzlösung und führen zur vollständigen Korrosion des
gesamten Bauteils und des Teststandes. Zudem spielen Faktoren wie pH-Wert,
Temperatur und Konzentration eine wichtige Rolle.
Neue Salzpaste: individuell anpassbar und nachhaltig
Forschende aus dem Fraunhofer LBF haben eine neue Salzpaste kreiert. Durch
eine maßgeschneiderte Anpassung der Zusammensetzung kann die Salzpaste
präzise an verschiedene Parameter der Einsatz- und Testszenarien
eingestellt werden. Zudem können vergleichbare Ergebnisse wie bei einem
traditionellen Salzsprühtest erreicht werden. Die neue Salzpaste eignet
sich gut für ein schnelles Screening bei der Materialauswahl und
Materialentwicklung. Dies ermöglicht eine effiziente und zielgerichtete
Bewertung neuer Materialien und deren Korrosionsbeständigkeit. Neben
klassischer Salzkorrosion könne bspw. auch saure oder basische Bedingungen
simuliert werden.
Die Salzpaste besteht aus bewährten Inhaltsstoffen wie einem
Superabsorber, Wollwachs, Fettalkoholen und Salzen. Durch die Verwendung
etablierter Rohstoffe und natürlicher Bestandteile wie Wollwachs sowie die
erheblich geringere Menge an benötigtem Material, reduziert die Salzpaste
den Ressourcen- und Energieverbrauch und minimiert somit die
umweltrelevanten Auswirkungen von Korrosionsprüfungen.
Korrosionsprüfung nachhaltig gestalten - Entwicklungspartner profitieren
Die Fraunhofer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen Partner aus
der Industrie, die Anwendungsfelder für Salzpasten in ihrem Unternehmen
sehen und die Möglichkeiten der neu entwickelten Salzpaste weiter
erschließen möchten. Der Einsatz ist in Korrosionsprüfungen von
Kunststoffen und Metallen, beispielsweise in der Maritimen Technik, unter
Wüstenklima, an PV-Anlagen oder an Beschichtungen auf Holz im Außenbereich
u.v.m. denkbar.
- Aufrufe: 11