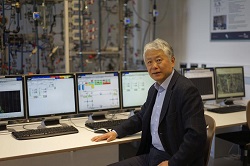„Erkenntnisse zur Katalyse finden internationale Beachtung“

NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes besucht das Max-Planck-Institut
für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr
Woran arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr derzeit? Und
was gibt es Neues auf dem Campus? Ina Brandes, Wissenschaftsministerin des
Landes Nordrhein-Westfalen, hat dem Institut jetzt einen Besuch
abgestattet. Dabei gewann sie spannende Einblicke in den Forschungsalltag
der geschichtsträchtigen Einrichtung, die heute rund 400 Menschen aus
knapp 40 Ländern beschäftigt.
„Wir befassen uns mit allen Aspekten der Katalyseforschung“, sagte Prof.
Ferdi Schüth, Geschäftsführender Direktor des Instituts. Er erklärte der
Ministerin, warum die Katalyse eine so wichtige Schlüsseltechnologie ist,
auch für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. So sind Forscherinnen
und Forscher des Instituts unter anderem involviert, wenn es darum geht,
an der chemischen Speicherung von Wasserstoff zu tüfteln oder
herauszufinden, wie man Sonnenenergie am besten chemisch binden kann.
Elementare Fragen also, wenn es um die Zukunft der Energiewirtschaft geht.
Aber auch für die meisten Reaktionen der chemischen Industrie und die
Herstellung von Arzneimitteln ist die Katalyse entscheidend.
Optimales Umfeld für wissenschaftliche Arbeit
Ministerin Ina Brandes: „In Nordrhein-Westfalen finden Forscherinnen und
Forscher von Weltruf ein optimales Umfeld für ihre wissenschaftliche
Arbeit. Die Erkenntnisse zur Katalyse etwa, die hier gewonnen werden,
finden international Beachtung. Besonders freut mich, dass Auszeichnungen
wie der Chemie-Nobelpreis für den wissenschaftlichen Direktor Benjamin
List vor zwei Jahren viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
anziehen und sie Nordrhein-Westfalen so zur Heimat der Spitzenforschung
machen.“
Die Ministerin hatte im Anschluss an den Austausch mit dem Vorstand
Gelegenheit, einen Blick in verschiedene Abteilungen des Instituts zu
werfen. In der Elektronenmikroskopie beispielsweise werden die Ergebnisse
der Experimentalchemikerinnen und –chemiker genauestens unter die Lupe
genommen. „Nur in Kooperation mit den analytischen Abteilungen ist es den
Kolleginnen und Kollegen möglich, die richtigen Schlüsse aus ihrer Arbeit
im Labor zu ziehen“, erklärte Ferdi Schüth.
Ein wichtiges Thema des ministerialen Besuchs war auch die zukünftige
Entwicklung des Campus. Das MPI hat sich in seiner knapp 110-jährigen
Geschichte stets fortentwickelt, und wird es auch weiterhin tun. Die
Digitalisierung von Prozessen und Abläufen sowie eine elegante und
effiziente Bündelung der Analytik sind nur zwei Schlagworte, die die
Kohlenforscher in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen werden.
Wie alle Institute der Max-Planck-Gesellschaft wird auch das MPI für
Kohlenforschung zu einem großen Teil gemeinsam durch den Bund und die
Länder finanziert. Das Ministerium ist auch mit einer Vertreterin oder
einem Vertreter Mitglied im Verwaltungsrates des Instituts.
Seit mehr als 100 Jahren betreibt das Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr chemische Grundlagenforschung und
hat seit seiner Eröffnung als Kaiser-Wilhelm-Institut 1914 zahlreiche
chemische Entdeckungen von historischer Tragweite gemacht. Es war das
erste Kaiser-Wilhelm-Institut außerhalb Berlins und die erste
wissenschaftliche Einrichtung im Ruhrgebiet überhaupt. Zu den wichtigsten
Errungenschaften gehört die Entdeckung der Fischer-Tropsch-Synthese in den
1920er Jahren, ein Verfahren zur Herstellung synthetischen Benzins,
seinerzeit auf der Basis von Kohle, das aber auch andere
Kohlenstoffquellen, wie das Kohlendioxid aus Abgasen oder sogar aus der
Luft nutzen kann.
Wirtschaftlich und wissenschaftlich sehr bedeutend – und ebenfalls mit dem
Chemienobelpreis ausgezeichnet - war das Niederdruckpolyethylenverfahre
von Karl Ziegler, das die wirtschaftliche Produktion von hochwertigen
Kunststoffen ermöglichte. Aber auch ein Verfahren zur Entkoffeinierung von
Kaffeebohnen wurde am MPI für Kohlenforschung entwickelt. Heute besteht
das Institut aus fünf wissenschaftlichen Abteilungen, die jeweils von
einem Direktor geleitet werden. Rund 400 Beschäftigte aus aller Welt
widmen sich der chemischen Grundlagenforschung mit Fokus auf die Katalyse.
- Aufrufe: 5