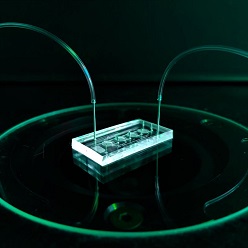DEN benennt Koordinator für künftiges Energieberater-Berufsbild Jochen Floescher soll Schwung bringen in eine komplizierte Diskussion
Er kommt vom Bau, er kennt sich aus, er hat viel von der Welt gesehen. Jochen Floescher (54), gelernter Schreiner und studierter Bauingenieur, jahrzehntelang in leitender Funktion für internationale Bau-Konzerne in Afrika, Arabien und Russland unterwegs, ist jetzt für das Deutsche Energieberater-Netzwerk DEN e.V. tätig. Er soll die vielfältigen Ideen und zahlreichen Initiativen, die sich um ein einheitliches Berufsbild für Energieberaterinnen und Energieberater drehen, koordinieren.
- Aufrufe: 1