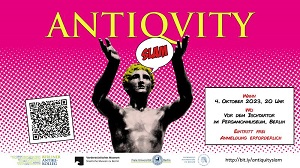Vom Singvogel bis zum Kranich - die jungsteinzeitliche Vogeljagd in Obermesopotamien

Für Jäger-Sammler-Gemeinschaften aus Obermesopotamien, heutige Türkei,
waren Vögel zu Beginn der Jungsteinzeit, ca. 9.000 Jahre v. Chr., eine
wichtige Nahrungsquelle. Das zeigt eine neue Studie der SNSB- und LMU-
Archäozoolog:innen Dr. Nadja Pöllath und Prof. Joris Peters. Die beiden
Wissenschaftler:innen untersuchten die Überreste von Vögeln aus den beiden
jungsteinzeitlichen Siedlungen Göbekli Tepe und Gusir Höyük in der
heutigen Türkei und veröffentlichten ihre Ergebnisse nun in der
Fachzeitschrift Archaeological and Anthropological Sciences.
Neben großen und kleinen Säugetieren, vom Auerochsen bis zum Hasen, oder
Fischen bejagten die Menschen in Südostanatolien vor 11.000 Jahren auch
das gesamte Spektrum an Vogelarten. Gejagt wurden sie vor allem, aber
nicht ausschließlich, im Herbst und Winter, d.h. dann, wenn viele
Vogelarten größere Schwärme bildeten und Zugvögel das Gebiet durchquerten.
Die Artenlisten sind daher sehr umfangreich: In der Ausgrabungsstätte der
frühsteinzeitlichen Siedlung Göbekli Tepe etwa, rund 18 km nordöstlich der
heutigen südanatolischen Stadt Şanlıurfa gelegen, fanden die
Forscher:innen Überreste von 84 Vogelarten. Dr. Nadja Pöllath, Kuratorin
an der Staatssammlung für Paläoanatomie München (SNSB-SPM) und Prof. Dr.
Joris Peters, Inhaber des Lehrstuhls für Paläoanatomie,
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin an der LMU München
sowie Direktor der Staatssammlung, identifizierten die jungsteinzeitlichen
Vögel mit Hilfe moderner Vergleichsskelette aus der Referenzsammlung der
Staatssammlung.
Überrascht hat die beiden im Falle von Göbekli Tepe die große Zahl von
kleinen Singvögeln, darunter vor allem Stare und Ammern. Grundsätzlich
haben die Jäger von Göbekli Tepe alle Le-bensräume in der Umgebung ihrer
Siedlung für die Vogeljagd aufgesucht. Gejagt wurde an Gewässern, in
Wäldern sowie auch im offenen Gelände.
„Warum am Göbekli Tepe so viele kleine Sperlingsvögel bejagt wurden,
wissen wir nicht genau. Aufgrund ihres geringen Lebendgewichts steht der
Aufwand eigentlich in keinem guten Verhältnis zum Ertrag. Vielleicht waren
sie einfach eine Delikatesse, die im Herbst den Speiseplan bereicherte,
oder sie hatten eine Bedeutung, die wir aus den Knochenresten noch nicht
ablesen können“, kommentiert Nadja Pöllath ihre Ergebnisse.
Die Bewohner von Gusir Höyük, einer ebenfalls frühneolithischen Siedlung
am Ufer des Gusir-Sees, etwa 40 km südlich der heutigen Provinzhauptstadt
Siirt, noch weiter im Südosten der heutigen Türkei, hielten es dagegen
anders: Sie begrenzten ihre Vogeljagd auf nur zwei Arten: das Chukar-
Steinhuhn (Alectoris chukar) und das Rebhuhn (Perdix perdix), die im
offenen hügeligen Grasland zu Hause waren. Nahegelegene Flussauen und den
See, an dessen Ufern die Siedlung lag, ignorierten sie offenbar, denn
Überreste von Wasservögeln fanden die Münchener Forscher:innen in Gusir
Höyük nicht. „Gusir Höyük ist die einzige uns bekannte jungsteinzeitliche
Gemeinschaft in Obermesopotamien, die bei der Vogeljagd – obwohl vorhanden
– bewusst Feuchtgebiete und Flusslandschaften mieden. Unsere Ergebnisse
deuten darauf hin, dass es sich dabei um eine kulturelle Eigenheit der am
Gusir Höyük siedelnden Gruppe handelt“, so Prof. Joris Peters. „Im
Vergleich mit anderen frühneolithischen Fundorten in der Region zeigten
sich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Orten im Euphratbecken, während im
Tigrisbecken die Gemeinsamkeit darin besteht, dass fast jede Siedlung eine
ganz eigene Strategie zur Nahrungsbeschaffung entwickelte“, ergänzt Nadja
Pöllath.
Nicht alle Vögel wurden auch von den jungsteinzeitlichen Siedlern
Obermesopotamiens gegessen. Manche Vogelarten wie z. B. Kraniche oder
Greifvögel hatten wohl eher symbolische Bedeutung und könnten auch
rituellen Zwecken gedient haben, vermuten die Forscher:innen. Solche
soziokulturellen Aspekte der Beziehungen zwischen Menschen und Vögeln gilt
es zukünftig zu untersuchen.
- Aufrufe: 1