Weiblicher Resilienz auf der Spur: Organ-on-Chip-Technologie ermöglicht neue Einblicke

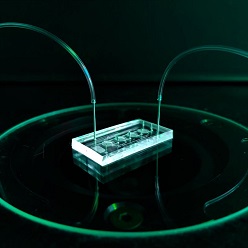
Dynamische Resilienz – dahinter verbirgt sich die Widerstandskraft
menschlicher Körper gegenüber unvorhergesehenen Veränderungen oder
Stressfaktoren. Ältere Menschen und speziell Frauen nach der Menopause
sind aufgrund einer verminderten dynamischen Resilienz einem erhöhten
Risiko ausgesetzt gravierende gesundheitliche Folgen zu erleiden als
Reaktion auf äußere Stresssituationen wie Krebstherapien oder Infektionen.
Der Frage, welche Rolle die weibliche Menopause auf die dynamische
Resilienz bei Frauen spielt und wie präventive und therapeutische
Maßnahmen dagegen entwickelt werden können, widmet sich eine
internationale Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Dr. Peter
Loskill.
Geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Alternsforschung
Das anspruchsvolle Forschungsprojekt zielt darauf ab, herauszufinden, wie
Stoffwechsel, Immunsystem und dynamische Resilienz bei Frauen vor und nach
der Menopause zusammenhängen und widmet sich damit in einzigartiger Weise
den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der Altersforschung.
"Derzeit besteht eine gravierende Lücke in unserer Fähigkeit die
dynamische Resilienz kontrolliert und detailliert zu untersuchen. Unser
Projekt zielt darauf ab diese Lücke zu schließen, indem wir eine
Resilienz-on-Chip-Plattform entwickeln, welche fortschrittliche
Technologie mit Fachwissen aus verschiedenen Bereichen kombiniert",
erklärte Prof. Dr. Peter Loskill, Leiter des Projekts und Brückenprofessor
für Organ-on-Chip-Systeme zwischen der Eberhard Karls Universität Tübingen
und dem NMI sowie Leiter des 3R-Centers Tübingen für In-vitro-Modelle und
Tierversuchsalternativen.
Antworten liefern modernste Multi-Organ-on-Chip-Plattforme
Die Forscher:innen setzen zur Beantwortung ihrer ambitionierten
Forschungsfragen auf die Kombination sogenannter Organ-on-Chip-Systeme mit
Einzelzell-Genomik. Dabei werden hormonempfindliche Organe wie das weiße
Fettgewebe, die Leber und lymphatisches Gewebe außerhalb des Körpers mit
Zellen weiblicher Spenderinnen gezüchtet, in etwa 1 €-Stück-großen
Polymerchips kultiviert und später durch künstliche Blutgefäße miteinander
verbunden. Mit diesen Testplattformen können zentrale Erkenntnisse über
das Zusammenspiel von Stoffwechsel, Immunsystem und dynamischer Resilienz
bei Frauen vor und nach der Menopause gewonnen werden. Durch die
Verwendung von Zellen von Frauen aus unterschiedlichen Lebensabschnitten
können so Veränderungen des Immunstoffwechsels als Reaktion auf
verschiedene Stressfaktoren untersucht und verglichen werden, wobei
Bedingungen wie Chemotherapie, Hormonveränderungen und Infektionen
simuliert und untersucht werden können.
Gemeinsam für eine verbesserte Frauengesundheit
Zum Team gehören, neben Loskills µOrganoLab auch die Co-Principal
Investigators Dr. Roser Vento-Tormo vom Wellcome-Sanger-Institute in
Cambridge, UK, Prof. Dr. Stefan Krauss von der Universität Oslo und Dr.
Nicole Schneiderhan-Marra ebenfalls vom NMI. Ihre gemeinsamen Bemühungen
versprechen Aufschluss darüber, wie Energiestoffwechsel, Immunreaktion und
Entzündungen die Resilienz beeinflussen und wie sich diese Faktoren im
Laufe des Lebens einer Frau entwickeln.
"Die geschlechtsspezifischen Lücken in der medizinischen Forschung zu
schließen ist eine Priorität, und unser Projekt ist ein wichtiger Schritt
in diese Richtung. Wir sind entschlossen, unser gemeinsames Fachwissen zu
nutzen, um positive Veränderungen voranzutreiben und das Leben von Frauen
weltweit zu verbessern", schloss Dr. Nicole Schneiderhan-Marra,
Bereichsleiterin Pharma und Biotech am NMI.
Weitere Informationen:
www.organ-on-chip.uni-tuebinge
Website der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Peter Loskill mit Informationen zu
allen laufenden Forschungsprojekten, dem aktuellen Forschungsstand sowie
Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die (Multi)Organ-on-Chip-
Technologie.
Über das NMI:
Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut in Reutlingen ist
eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung und betreibt
anwendungsorientierte Forschung an der Schnittstelle von Bio- und
Materialwissenschaften. Es verfügt über ein einmaliges, interdisziplinäres
Kompetenzspektrum für F&E- sowie Dienstleistungsangebote für regional und
international tätige Unternehmen. Dabei richtet sich das Institut
gleichermaßen an die Gesundheitswirtschaft sowie Industriebranchen mit
werkstofftechnischen und qualitätsorientierten Fragestellungen wie
Fahrzeug-, Maschinen- und Werkzeugbau.
Das Forschungsinstitut gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche, die durch
ein gemeinsames Leitbild miteinander verbunden sind: Die Suche nach
technischen Lösungen erfolgt stets nach höchsten wissenschaftlichen
Standards. Im Geschäftsfeld Pharma und Biotech unterstützt das NMI die
Entwicklung neuer Medikamente mit biochemischen, molekular- und
zellbiologischen Methoden. Neben analytischen Fragestellungen erforscht
und entwickelt der Bereich Biomedizin und Materialwissenschaften
Zukunftstechnologien wie die personalisierte Medizin und Mikromedizin für
neue diagnostische und therapeutische Ansätze. Im Fokus des
Dienstleistungsangebotes steht für Kunden die Strukturierung und
Funktionalisierung von Werkstoffen und deren Oberflächen.
Über die Landesgrenzen hinaus ist das NMI für sein Inkubatorkonzept für
Existenzgründer mit bio- und materialwissenschaftlichem Hintergrund
bekannt.
www.nmi.de
Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut in Reutlingen
wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes
Baden-Württemberg unterstützt und ist Mitglied der Innovationsallianz
Baden-Württemberg, einem Zusammenschluss von 12 außeruniversitären und
wirtschaftsnahen Forschungsinstituten.
www.innbw.de







