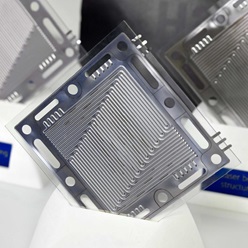Rauscharme Verstärker des Fraunhofer IAF an Bord des Arctic Weather Satellite
Erstmals genaue Wetterdaten für die Arktis erheben und weltweit
Vorhersagen sowie Klimabeobachtungen verbessern – das ist die Aufgabe des
Arctic Weather Satellite, den die ESA Mitte August auf den Weg zu seiner
erdnahen Umlaufbahn geschickt hat. Das hochmoderne Mikrowellenradiometer,
das er dafür nutzt, enthält vier rauscharme Verstärker des Fraunhofer IAF
mit weltweit führender InGaAs-mHEMT-Technologie. Auf der EuMW 2024 in
Paris präsentiert das Freiburger Institut vom 24. bis zum 26. September
Ausstellungsexemplare der im AWS verbauten Verstärker ebenso wie weitere
Hochfrequenzelektronik aus den Anwendungsbereichen
Satellitenkommunikation, Mobilfunk oder Tieftemperatur-Messtechnik.
Der Arctic Weather Satellite (AWS) der Europäischen Raumfahrtorganisation
(European Space Agency, ESA) wurde am 16. August 2024 auf die Reise zu
seiner polaren Umlaufbahn in 600 km Höhe über der Erde geschickt. Mit an
Bord: Vier rauscharme Verstärker (low-noise amplifiers, LNAs) des
Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF aus Freiburg. Sie
bilden wesentliche Bestandteile des passiven Mikrowellenradiometers, mit
dem der AWS Temperatur und Feuchtigkeit in der Arktis so präzise wie nie
zuvor misst. Dies soll dazu beitragen, sowohl die Arktis als auch den
Klimawandel, der in ihr besonders sichtbar wird, besser zu verstehen. Ist
die Mission erfolgreich, plant die ESA eine weltumspannende Konstellation
aus baugleichen Kleinsatelliten in das Weltall zu bringen, um im globalen
Maßstab präzisere und kurzfristigere Wettervorhersagen (›Nowcasting‹)
sowie Klimabeobachtungen zu ermöglichen.
Die Aufgabe von LNAs in technischen Systemen besteht darin, die Qualität
eingehender Signale zu verbessern. Wie ihr Name schon sagt, verstärken sie
schwache Signale und verursachen dabei möglichst geringe störende
Hintergrundgeräusche (Rauschen), damit Signale leichter erkannt und
analysiert werden können. Auf diese Weise erhöhen LNAs die Empfindlichkeit
von Systemen.
»Je leistungsfähiger ein rauscharmer Verstärker ist, desto genauer und
zuverlässiger kann ein System Daten erheben. Bei der satellitenbasierten
Erdbeobachtung spielen sie eine große Rolle, da die Mikrowellenstrahlung,
die das Satellitenradiometer erreicht, sehr schwach ist«, erläutert Dr.
Fabian Thome, Stellvertretender Geschäftsfeldleiter Hochfrequenzelektronik
am Fraunhofer IAF. »Es ist eine großartige Bestätigung und Motivation,
dass wir mit unseren LNAs zur besseren Erforschung der Arktis und ihrer
Auswirkungen auf das Weltklima beitragen können.«
Fraunhofer IAF trägt LNAs für Frequenzbereiche um 54, 89 und 170 GHz zum
AWS-Radiometer bei
Das Mikrowellenradiometer des AWS besteht aus einer Drehantenne, die die
von der Erdoberfläche ausgehende natürliche Mikrowellenstrahlung aufnimmt
und an vier Hornantennen sowie vier Empfänger weiterleitet. Antenne und
Empfänger gehören jeweils zu einer von vier Gruppen aus insgesamt 19
Kanälen, die zusammen ein Frequenzspektrum von 50 bis 325 GHz abdecken:
Acht Kanäle mit Frequenzen von 50 bis 58 GHz messen die Temperatur, ein
Kanal mit 89 GHz erkennt Wolken, ein weiterer bei 165,5 GHz sowohl Wolken
als auch Feuchtigkeit, fünf Kanäle zwischen 176 und 182 GHz sind nur für
die Feuchtigkeit zuständig, während zuletzt vier Kanäle bei 325 GHz
plus/minus 1,2 bis 6,6 GHz Feuchtigkeit messen sowie ebenfalls Wolken
erfassen. Mit dieser technischen Ausstattung ist es dem Radiometer
möglich, hochauflösende vertikale Feuchtigkeits- und Temperaturprofile
unter allen Wetterbedingungen zu erstellen.
Das Fraunhofer IAF hat insgesamt vier LNAs für drei der vier Kanalgruppen
bereitgestellt: ein Modul für den Frequenzbereich um 54 GHz, zwei
identische Module für 89 GHz, die für eine größere Gesamtverstärkung in
Reihe geschaltet wurden, und ein Modul für den 170-GHz-Bereich. Die
Forschenden haben bewährte Technologien auf Basis des
Verbindungshalbleiters Indiumgalliumarsenid (InGaAs) weiterentwickelt und
auf ihrer Grundlage metamorphe Transistoren mit hoher
Elektronenbeweglichkeit (metamorphic high-electron-mobility transistors,
mHEMTs) für monolithisch integrierte Mikrowellenschaltungen (monolithic
microwave integrated circuits, MMICs) realisiert.
Weltweit führende InGaAs-mHEMT-Technologie für LNA-MMICs
»Bei der Entwicklung von Transistoren und Schaltungen für
satellitengestützte Radiometrie-Systeme ist das Fraunhofer IAF weltweit
führend. Unsere Module definieren in vielen Leistungsbereichen den
aktuellen Stand der Technik«, betont Thome. Dies zeigt sich auch am
Beispiel der Module für das AWS-Radiometer: In Tests hat der LNA für den
Frequenzbereich um 54 GHz bei einer Verstärkung von 31 bis 28 dB eine
Rauschzahl von 1,0 bis 1,2 dB erreicht und verbessert damit deutlich den
Stand der Technik. Die anderen AWS-LNAs bewegen sich mit Rauschzahlen von
1,9–2,3 dB bei 23–25 dB Verstärkung (89 GHz) und 3,3–4,1 dB bei 25–30 dB
Verstärkung genau im Bereich des aktuellen Stands der Technik (John et al.
2023).
Bei der Entwicklung der Module arbeiteten die Forschenden eng mit dem
direkten Auftraggeber ACC Omnisys (AAC Clyde Space) aus Schweden zusammen,
der das Radiometersystem für OHB Sweden und die ESA gebaut hat. Bei der
Entwicklung und Fertigung der Module konnte das Fraunhofer IAF seine
Forschungsinfrastruktur und das Know-how seiner Mitarbeitenden entlang der
gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz bringen: Teams aus den Bereichen
Mikroelektronik, Epitaxie, Technologie und Feinmechanik haben eng
zusammengearbeitet und vom Schaltungsentwurf über Materialwachstum,
-bearbeitung und -messung sowie Prozessierung, Vereinzelung, Aufbautechnik
bis hin zum Modulbau und der -integration alle wesentlichen Schritte bis
zum einsatzbereiten LNA-Module am Fraunhofer IAF durchgeführt. Eine erste
Qualifikation der Module für den Einsatz im Weltall fand ebenfalls am
Institut statt, bevor die Hardware für die Receiver-Integration übergeben
wurde.
AWS und EPS-Sterna: Mit New Space zu präziseren Wettervorhersagen,
Nowcasting und Klimabeobachtung
Die Mission des AWS besteht darin, erstmals genauere Wetterdaten für die
Arktis zu ermitteln, die kurzfristige Vorhersagen für die Polarregion
ermöglichen – bis hin zum sogenannten Nowcasting, das Vorhersagen für die
nächsten Stunden bezeichnet. Da die Arktis das weltweite Wetter stark
beeinflusst, ermöglichen die Daten auch bessere globale Wettervorhersagen.
Das gilt auch für das Klima: Der Klimawandel schreitet in der Arktis
schneller voran als in anderen Regionen der Welt. Zugleich wirken sich
Veränderungen in der Arktis aufgrund von Rückkopplungseffekten auf das
Weltklima aus.
Im Erfolgsfall soll eine ganze Konstellation von baugleichen
Kleinsatelliten dem AWS folgen: das EUMETSAT Polar System – Sterna (EPS-
Sterna). Geplant ist, immer sechs Satelliten zur gleichen Zeit auf drei
verschiedenen Erdumlaufbahnen langfristige Wetterdaten der Polarregionen
erheben zu lassen. Das Satellitenset wird dreimal erneuert, so dass
insgesamt 18 Satelliten zum Einsatz kommen. Zwei Satelliten sind als
Ersatz eingeplant. 2029 soll der erste von sechs EPS-Sterna-Satellit
starten.
Mit diesem Vorhaben verfolgt die ESA erstmals den New-Space-Ansatz, der
sich dadurch auszeichnet, dass Projekte in kürzester Zeit mit deutlich
geringerem Ressourceneinsatz durchgeführt werden. Im Fall des AWS, dessen
Gesamtmasse nur 150 kg beträgt, vergingen vom Projekt- bis zum
Raketenstart nur drei Jahre, in denen ein Bruchteil der Kosten verglichen
mit früheren Projekten anfiel. Weitere Vorteile von New Space bestehen in
der größeren Resilienz von Konstellationen – der Ausfall eines Satelliten
im Verbund kann kompensiert bzw. schnell und günstig ersetzt werden – und
in der Flexibilität von Missionen, die bei Bedarf ohne großen
Ressourceneinsatz verlängert oder verkürzt werden können.
Fraunhofer IAF auf der EuMW 2024
Vom 24. bis zum 26. September 2024 präsentiert das Fraunhofer IAF
Ausstellungsexemplare der im AWS-Radiometer verbauten LNA-Module ebenso
wie weitere Hochfrequenzelektronik aus den Anwendungsbereichen
Satellitenkommunikation, Mobilfunk oder Tieftemperatur-Messtechnik auf der
diesjährigen European Microwave Week (EuMW) in Paris (Stand: 202K).
Forschende sind außerdem mit folgenden Themen im Konferenzprogramm
vertreten:
Sonntag, 22.9., 8:30–12:20 Uhr, WS09 EuMC, Raum 725–726
Dr. Laurenz John: »THz circuit and front-end developments based on InGaAs-
channel mHEMT devices«
Montag, 23.9., 8:30 Uhr, EuMIC03, Raum E04
Dr. Axel Tessmann: »High-Gain 664 GHz Low-Noise Amplifier Modules Based on
Advanced InGaAs HEMT Technologies«
Montag, 23.9., 16:50 Uhr, EuMIC14-3, Raum E02
Dr. Philipp Neininger: »mm-Wave GaN Varactors and E-/W-Band Phase Shifter«
Am Mittwoch, den 25. September, können Studierende und Berufseinsteigende
aus dem Fachbereich Mikrowellentechnologie das Fraunhofer IAF zudem beim
Young Professionals’ Career Event kennenlernen, das von 12 bis 15 Uhr in
Halle 7.3 der Paris Expo Porte de Versailles stattfindet. Die Teilnahme
ist kostenlos. Ab 19 Uhr findet im Chalet du Lac (avenue Anna
Politovskaïa, 75012 Paris) die dazugehörige Career Party statt. Tickets
dafür erhalten Interessierte beim Nachmittagsevent.
------------------------------
Über das Fraunhofer IAF
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF ist eine der
weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der
III/V-Halbleiter und des synthetischen Diamanten. Auf Basis dieser
Materialien entwickelt das Fraunhofer IAF Bauelemente für zukunftsweisende
Technologien, wie elektronische Schaltungen für innovative Kommunikations-
und Mobilitätslösungen, Lasersysteme für die spektroskopische Echtzeit-
Sensorik, neuartige Hardware-Komponenten für Quantencomputer sowie
Quantensensoren für industrielle Anwendungen. Mit seinen Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten deckt das Freiburger Forschungsinstitut die gesamte
Wertschöpfungskette ab – angefangen bei der Materialforschung über Design
und Prozessierung bis hin zur Realisierung von Modulen, Systemen und
Demonstratoren. https://www.iaf.fraunhofer.de
- Aufrufe: 15