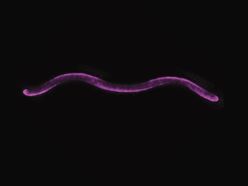Was bringt Bakterien in Form?

Bakterien kommen in vielen verschiedenen Formen vor, die eine wichtige
Rolle für das Überleben in ihrer jeweiligen ökologischen Nische spielen.
Wie sie ihre Zellform bestimmen, ist bisher in vielen Fällen trotz
intensiver Forschung nicht bekannt. Forschende um Prof. Martin Thanbichler
deckten den Mechanismus der Formgebung nun für spiralförmige
Rhodospirillen auf und ermöglichen dadurch neue Einblicke in den
Zusammenhang von Zellform und Fitness.
Stellen Sie sich eine Bakterie vor. Wie sieht sie aus – rundlich, oder
stäbchenförmig? Tatsächlich sind Bakterien erstaunlich vielgestaltig.
Neben den stäbchenförmigen Vertretern, wie dem Laborbakterium E. coli,
gibt es zum Beispiel zahlreiche gekrümmte und sogar spiralförmige
Bakterien. Das ist keine Laune der Natur: die Krümmung ist ausschlaggebend
für die Fähigkeit der Bakterien, Oberflächen zu besiedeln, sich in
zähflüssigen Umgebungen zu bewegen - und damit auch, Krankheiten
auszulösen, wie es z.B. für Vibrio cholerae oder Helicobacter pylori der
Fall ist. Forschende weltweit arbeiten daran, die molekularen Einzelheiten
der Krümmung zu verstehen, um sie vielleicht einmal beeinflussen und so
z.B. Krankheiten heilen zu können.
Nun liefern Forscherinnen und Forscher um Max-Planck-Fellow Martin
Thanbichler, Professor an der Philipps-Universität Marburg, neue Einblicke
in die Formgebung in dem photosynthetischen Bakterium Rhodospirillum
rubrum. Diese Spezies ist in der Umwelt weit verbreitet und besitzt auch
biotechnologisches Potenzial, da sie Kohlenmonoxid verwerten, Stickstoff
fixieren und sowohl Wasserstoff als auch Bausteine für Bioplastik
produzieren kann.
Die Forschenden fanden überraschenderweise, dass zwei sogenannte Porine –
kanalartige Proteine, die üblicherweise nur für den Austausch von
Nährstoffen über die äußere Membran der Bakterien verantwortlich sind –
schraubenförmig in der äußeren Krümmung der Bakterienzellhülle angeordnet
sind. Diese Strukturen sind über ein weiteres Protein, das Lipoprotein
PapS, eng mit der Zellwand verbunden. Überraschend war: fehlte PapS, oder
verhinderten die Forschenden dessen Bindung an die Porine, wurden die
Zellen vollkommen gerade.
Doch warum ist PapS für die Zellkrümmung unerlässlich? „Offenbar haben
die Porine im Lauf der Evolution neben dem Nährstoffaustausch eine zweite
Funktion übernommen,“ erklärt Prof. Martin Thanbichler. „Sie kontrollieren
zusammen mit PapS die Bewegung einer molekularen Maschine, die sich in
kreisförmigen Bahnen um den Zellkörper bewegt, dabei in die bestehende
Zellwand neues Material einbaut und so zu einer Zellverlängerung führt. In
stäbchenförmigen Bakterien wie E. coli läuft dieser Prozess in allen
Bereichen der Zelle gleichmäßig ab, so dass eine gerade Form zustande
kommt. In Rhodospirillum hingegen bildet die schraubenartige Porin-PapS-
Struktur durch seine dichte Packung eine Art molekularen Käfig. Dieser
umschließt die Maschinerie, die für das Längenwachstum der Zelle
verantwortlich ist, und fixiert sie dadurch teilweise in der äußeren
Biegung der Bakterienzellwand. Auf diese Weise kommt es dort lokal zu
einem verstärkten Wachstum, was zur Krümmung der Bakterienzelle führt.“
Die Studie, an der neben dem Marburger Team auch Forschende aus Kiel,
Freiburg, England und Australien beteiligt waren, hat damit einen
neuartigen Mechanismus der Formgebung in Bakterien aufgedeckt, der auf
einem direkten Einfluss von Porinen auf die räumliche Kontrolle des
Zellwachstums beruht. Die erhaltenen Erkenntnisse treffen wahrscheinlich
für alle gekrümmten Mitglieder der Rhodospirillen zu. Die Forschenden
wollen nun herausfinden, ob dieser Mechanismus auch bei anderen
Bakteriengruppen mit komplexeren Zellformen Verwendung findet.
„Wir haben nun die Möglichkeit, die Zellform von Rhodospirillum rubrum
gezielt zu verändern, und können so die selektiven Vorteile untersuchen,
die ein spiraliger Zellkörper für Bakterien in der Umwelt hat“, erklärt
Dr. Sebastian Pöhl, der Erstautor der Studie. Das könnte wichtige Hinweise
darauf geben, wie sich die Zellform auf die Besiedelung ökologischer
Nischen, das Eingehen symbiotischer Interaktionen mit Pflanzen oder auch
das Verursachen von Krankheiten auswirkt.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Martin Thanbichler
Max-Planck Fellow Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie,
Marburg +49 6421 28-21809
Originalpublikation:
Pöhl, S., Giacomelli, G., Meyer, F.M.; Kleeberg, V.; Cohen, E. J.; Biboy,
J.; Rosum, J.; Glatter, T.; Vollmer, W.; van Teeseling, M.; Heider, J.;
Bramkamp, M.; Thanbichler, M.
An outer membrane porin-lipoprotein complex modulates elongasome movement
to establish cell curvature in Rhodospirillum rubrum
Nature Communications 15 (2024)
- Aufrufe: 19