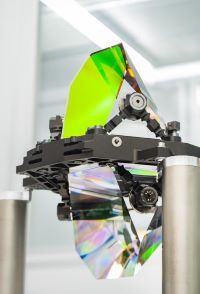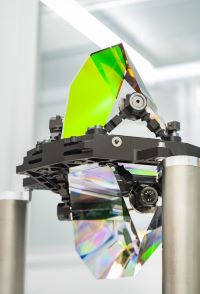Fachkräftemangel in der Bildung: „Wir brauchen kreative Lösungen“
In Deutschland herrscht in allen Bildungsbereichen ein Mangel an
Fachkräften, der sich in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter
verschärfen wird. Wissenschaftler*innen aus dem Leibniz-Forschungsnetzwerk
Bildungspotenziale (LERN) haben nun in einem Positionspapier konkrete
Vorschläge erarbeitet, um dieser Problemlage entgegenzuwirken – in den
Bereichen der frühen Bildung, der Schule, der Erwachsenen- und
Weiterbildung sowie in Bezug auf das Thema Diversität. Das
Forschungsnetzwerk diskutiert den Fachkräftemangel in der Bildung außerdem
heute auf dem Bildungspolitischen Forum in Berlin.
„Wenn wir dem Fachkräftemangel in weiten Teilen des Bildungssystems
begegnen wollen, reicht die langfristig angelegte Neuqualifizierung von
Personal alleine nicht aus. Wir brauchen kreative Lösungen, um jetzt und
unmittelbar auf die Entwicklung reagieren zu können“, so die Autor*innen
des Positionspapiers. Die Forschenden unterstreichen die Dringlichkeit
dieses Anliegens: „Eine anhaltende Unterbesetzung im Bildungswesen erfolgt
auf Kosten aller Lehrenden und Lernenden. Zum einen erhöht sie den Druck
auf die bestehenden Beschäftigten und verschlechtert deren
Arbeitsbedingungen. Zum anderen sinkt die Qualität der Bildungsangebote
und damit die Gesamtqualifizierung der Bevölkerung. Insgesamt
verschlechtern sich die Chancen durch Bildung.“
In dem Positionspapier stellen die Expert*innen des LERN-
Forschungsnetzwerks unterschiedliche Vorschläge vor. Im Bereich der frühen
Bildung sehen sie beispielsweise Potenzial für multiprofessionelle Teams,
ältere Menschen vermehrt für Aufgaben in den Kitas zu gewinnen und
Betreuungsumfänge, die von Kindern nicht genutzt werden, umzuverteilen.
Für die Schule fordern sie unter anderem einen digital ganzheitlich
weiterentwickelten Unterricht, der das Lehren und Lernen klug unterstützt,
verstärkte professionsübergreifende Kooperationen und eine Entlastung der
Lehrkräfte von Organisations- und Verwaltungsaufgaben. Im
Weiterbildungsbereich betonen sie die Dringlichkeit, die
Beschäftigungsbedingungen von Lehrkräften – was Bezahlung und Sicherheit
angeht – zu verbessern. Das gelte vor allem für Bildungsbereiche von
besonderem öffentlichem Interesse wie der sprachlichen Grundbildung von
Zugewanderten. Zudem brauche es neue, übergreifende Strategien und
Strukturen zur Rekrutierung und Fortbildung des Personals.
In Bezug auf das Thema Diversität sehen die Forschenden einen von den
Bildungsabschnitten unabhängigen Weg, um dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. So sei es wichtig, vermehrt Personen aus bisher
unterrepräsentierten Gruppen zu gewinnen und in der Berufsausübung
verstärkt zu unterstützen. Das können beispielsweise Personen mit
Zuwanderungsgeschichte sein. Hierfür bedürfe es jedoch gezielter Maßnahmen
– zum Beispiel eine leichtere Anerkennung ausländischer Abschlüsse, eine
kultursensible Berufsberatung in verschiedenen Sprachen, eine verbesserte
soziale Integration in der Ausbildung und eine diversitätssensiblere
Organisationskultur in den Bildungseinrichtungen.
Bildungspolitisches Forum und Forschungsnetzwerk:
Unter dem Titel „Fachkräftemangel in der Bildung: Chancen und
Perspektiven“ diskutiert das Forschungsnetzwerk das Thema heute auf dem
Bildungspolitischen Forum in Berlin. Die jährliche Veranstaltung widmet
sich stets aktuellen Herausforderungen im Bildungswesen und wendet sich an
die Fachwelt in Politik, Forschung und Verwaltung. In diesem Jahr findet
die Veranstaltung in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) als Präsenzveranstaltung statt – inklusive Livestream
ausgewählter Inhalte. Inhaltlich verantwortlich sind das DIPF | Leibniz-
Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, das Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung (BiB) und das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE).
Das Forum umfasst unter anderem eine Keynote, vielfältige Diskussionsforen
und einen moderierten Bildungsdialog.
Im Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (Leibniz Educational
Research Network, LERN) haben sich Wissenschaftler*innen aus
Erziehungswissenschaft, Fachdidaktiken, Linguistik, Kultur-, Medien- und
Neurowissenschaften, Ökonomie, Politikwissenschaft, Psychologie,
Soziologie, Sprachwissenschaft sowie Informationswissenschaft und
Informatik an 27 Einrichtungen zusammengeschlossen, um ihre Expertise zu
bündeln und Entscheidungsträger* innen in der Bildungsadministration zu
beraten. Gemeinsam arbeiten sie daran, wie die Potenziale von Bildung und
für Bildung besser nutzbar gemacht werden können. Ziel ist es, auf
individueller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene Ansatzpunkte
für tragfähige Konzepte und erfolgversprechende Reformen zu finden.
Weitere Informationen:
• Das Positionspapier:
<www.leibniz-bildung.de/pospap
• Über das heutige Bildungspolitische Forum – inklusive Link auf den
Live-Stream:
<www.leibniz-bildung.de/verans
bildung-chancen-und-perspektiv
• Über das Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN):
<www.leibniz-bildung.de>
- Aufrufe: 23