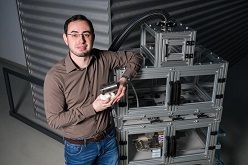Deutscher Verkehrssicherheitsrat BMVI muss handeln: Beschlüsse der VMK für einen sicheren Straßenverkehr
Nach der heute endenden Verkehrsministerkonferenz (VMK) sieht der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in der Pflicht zu handeln. „Gerade angesichts der gestiegenen Zahl von Getöteten im Straßenverkehr – darunter deutlich mehr Radfahrer – müssen die Beschlüsse der VMK umgesetzt werden“, fordert DVR-Präsident Prof. Dr. Walter Eichendorf. Konkreten Handlungsbedarf sieht er bei der fahrradfreundlichen Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Erhöhung des Sanktionsniveaus bei Verkehrsverstößen. Bezüglich der Elektrokleinstfahrzeuge-
Elektrokleinstfahrzeuge auf Gehwegen nur mit Schrittgeschwindigkeit
Fußgänger, insbesondere ältere, Kinder und Menschen mit Behinderungen, benötigen besonderen Schutz bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Aus diesem Grund bedauert der DVR, dass die VMK den Verordnungsentwurf des BMVI nicht modifiziert hat. Der Entwurf sieht vor, dass EKF bis zu einer Geschwindigkeit von 12 km/h auf Gehwegen fahren dürfen. „Viele Fachleute haben für die Schrittgeschwindigkeit von 6 km/h plädiert. Man könne darüber hinaus nur hoffen, dass der Bundesrat bis zu seiner Abstimmung über den Verordnungsentwurf im Mai den darin enthaltenen Vorschlag für ein Mindestalter von 12 Jahren für die Nutzung von EKF bis 12 km/h und von 14 Jahren für die Nutzung von EKF zwischen 12 und 20 km/h noch einmal überdenkt. „Kinder im Alter von zwölf bzw. 14 Jahre können das komplexe Verkehrsgeschehen nur bedingt richtig einschätzen“, so der Präsident. Das bedeute ein Unfallrisiko für sie selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer.
Sicher Rad fahren mit einer fahrradfreundlichen StVO
Der DVR begrüßt die konkreten Vorschläge der Ad-hoc Arbeitsgruppe Radverkehrspolitik der VMK, die eine fahrradfreundliche Novellierung der StVO und der dazugehörigen VwV-StVO ermöglichen. Vorgesehen ist u.a. eine Innovationsklausel für zeitlich und örtlich begrenzte Pilotprojekte. „Der DVR erwartet vom BMVI, dass die Ideen ernst genommen werden und ein Entwurf zur fahrradfreundlichen Novelle der StVO, wie von der VMK gefordert, bis Ende des Jahres erarbeitet wird“, so Eichendorf. Eine Frage, die zwingend beantwortet werden müsse, sei, wie der Straßenraum künftig aufgeteilt werden müsse, damit alle, die Rad fahren, sicher ankommen. Gerade in Kreuzungsbereichen müssten die Sichtbeziehungen verbessert werden. Überholen sollte auch für Radfahrer keine Gefahr darstellen.
Fördermittel zur Nachrüstung von Abbiegeassistenten erhöhen
Mit Blick auf die vielen Rechtsabbiegeunfälle zwischen Radfahrern bzw. Fußgängern und Lkw schließt sich der DVR der Forderung der VMK an, die Fördermittel zur freiwilligen Nachrüstung mit Abbiegeassistenzsystemen zu erhöhen. Ziel müsse es sein, so viele Lkw und Nutzfahrzeuge wie möglich mit Abbiegeassistenten auszustatten, sagt der Präsident. Dafür sei es zudem unabdingbar, dass mehr Hersteller eine Betriebserlaubnis für ihre Systeme erhielten.
Reform des Bußgeldkatalogs weiter vorantreiben
Enttäuscht zeigt sich Prof. Dr. Eichendorf, dass das BMVI die Forderung der VMK, ein Eckpunktepapier zum Bußgeldkatalog zu erarbeiten, bislang nicht aufgegriffen hat. „Für die Verkehrssicherheit ist das schlecht“. Die Sanktionshöhe des Bußgeldkatalogs sei im europaweiten Vergleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Damit sei auch der Anreiz, die Regeln einzuhalten, eher gering, urteilt der Präsident. „Unsere Botschaft muss sein: Im Straßenverkehr gibt es Gesetze und Regeln, die eingehalten werden müssen. Schließlich geht es um das eigene Leben und das anderer.“ Ein gutes Signal sei deshalb der Beschluss der VMK, eine Länderarbeitsgruppe einzurichten, die Verkehrsordnungswidrigkeiten mit hohem Gefährdungspotenzial identifizieren und Vorschläge für die Anhebung des Sanktionsniveaus erarbeiten soll.
Aufgabe der Länder sei es, das Personal bei der Polizei, in Bußgeldstellen und Gerichten aufzustocken. „Wird der Straßenverkehr nicht ausreichend überwacht, bleiben die Sanktionen auf dem Papier wirkungslos“, so der DVR-Präsident.
- Aufrufe: 482