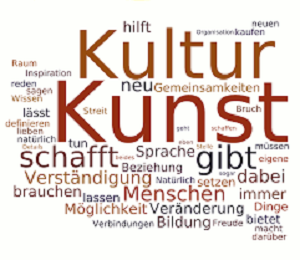Warum fachfremde Personen auf Professuren für Hebammenwissenschaft?
Hebammenwissenschaftlicher Fachbereichstag (HWFT) beklagt Tendenz zur
Fehlbesetzung von hebammenwissenschaftlichen Professuren an Hochschulen
mit einem Studium von Hebammen.
Die mit Inkrafttreten des Hebammengesetzes (2019) vollzogene Überführung
der Ausbildung von Hebammen an die Hochschulen diente der Umsetzung der
EU-Richtlinie 2005/36/EG und leitete einen umfassenden Reformprozess ein.
Der Gesetzgeber reagierte damit zudem auf die gestiegene Komplexität und
Anforderungen an die Berufspraxis von Hebammen. Dabei sind Hebammen nicht
nur für die Geburtshilfe, sondern auch für die prä- und postnatale
Betreuung von Frauen* und ihren Neugeborenen verantwortlich. Als
Expert:innen für Gesundheitsförderung und Prävention tragen sie maßgeblich
zur Verbesserung der Mutter-Kind- und Familiengesundheit bei. Diese
Expertise erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung auf der
Grundlage hebammenwissenschaftlicher Forschung und Lehre. Somit muss
zwingend sichergestellt werden, dass die Disziplin „Hebammenwissenschaft“
analog internationaler Entwicklungen auch an den Hochschulen in
Deutschland den erforderlichen hochschulischen Raum und Rahmen erhält, der
allen Disziplinen für den notwendigen Fortschritt in fachspezifischer
Forschung und Lehre zugestanden wird.
Derzeit ist dieses hochschulische Selbstverständnis jedoch nicht an allen
Hochschulstandorten mit einem Studium von Hebammen erkennbar. So wurden
bereits verschiedene hebammenwissenschaftliche Professuren mit
disziplinfremdem Personal unbefristet besetzt und darüber hinaus mit der
Funktion der Studiengangs- oder Institutsleitung betraut. Damit werden
tradierte Hierarchien aus Kliniken auf Hochschulen übertragen und die
junge Disziplin Hebammenwissenschaft in ihrer Eigenständigkeit von Beginn
an beschränkt und fremdbestimmt. Übergangslösungen wie bspw.
Vertretungsprofessuren oder befristete Lösungen werden nicht gewählt,
obgleich der Nachwuchsmangel bei Hebammenwissenschaftler:innen ein
vorübergehendes Phänomen ist. Da fachfremde Berufungen auch in der
Pflegewissenschaft ein bekanntes Problem sind, muss von einer
schwerwiegenden systemischen Fehlsteuerung in der akademischen Entwicklung
der Gesundheitsdisziplinen ausgegangen werden. Eine weitere Übertragung
des Phänomens auf die Therapieberufe ist zu befürchten.
Gemäß § 20 (2) des Hebammengesetzes darf die Studiengangsleitung nur von
Personen ausgeübt werden, welche selbst über die Erlaubnis zum Führen der
Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 des Hebammengesetzes in der bis zum
31. Dezember 2019 geltenden Fassung verfügen.
„Vor diesem Hintergrund fordert der Hebammenwissenschaftliche
Fachbereichstag nachdrücklich eine Regelung, welche die Leitung im Studium
von Hebammen nicht nur an das hebammenwissenschaftliche Fach, sondern
explizit auch an die hochschulübliche wissenschaftliche, professorale
Qualifikation bindet und damit die Besetzung hebammenwissenschaftlicher
Professuren unmittelbar sicherstellt“, sagt Professorin Dr.in Melita
Grieshop, Präsidentin des HWFT und Studiengangsleitung für das Studium von
Hebammen an der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB). Die zur Zeit zwar
noch geringe, aber stetig steigende Anzahl akademisch qualifizierter und
promovierter Hebammenwissenschaftler:innen in Deutschland wird sich in den
nächsten Jahren aufgrund der Etablierung von Qualifizierungsprogrammen auf
Master- und Promotionsniveau rasch und nachhaltig vergrößern. „Deshalb
kann dies keinesfalls als Begründung dienen, die hebammenwissenschaftlich
ausgeschriebenen Professuren fachfremd, beispielsweise durch
Mediziner:innen, zu besetzten“, betont Melita Grieshop. Jede Fehlbesetzung
hat erhebliche und langfristige negative Auswirkungen auf den Zugang zu
Drittmitteln und damit auf die Machbarkeit der erforderlichen
hebammenwissenschaftlichen Forschung mit gesundheitsfördernder und
präventiver Ausrichtung.
Aus den aufgeführten Gründen lehnt der Hebammenwissenschaftliche
Fachbereichstag (HWFT) eine Besetzung hebammenwissenschaftlicher
Professuren mit Personen aus Nachbardisziplinen ohne
hebammenwissenschaftliche Qualifikation entschieden ab. Der HWFT fordert
die Entscheidungsträger in Wissenschaft, Gesundheit und Politik sowie an
den Hochschulen selbst auf, zeitnah die notwendigen und eigentlich
hochschulüblichen Entwicklungsbedingungen in Forschung und Lehre, auch in
der Hebammenwissenschaft, durch eine fachspezifische Personalbesetzung,
insbesondere in hebammenwissenschaftlichen Leitungsfunktionen,
sicherzustellen.
- Aufrufe: 4