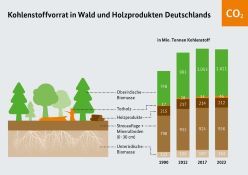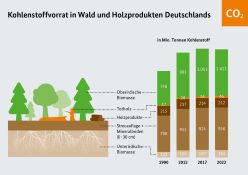Laser-Technologien für die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft
Das 5. Laser Colloquium Hydrogen 2024 - LKH2 am 10. und 11. September 2024
brachte rund 60 ausgewiesene Fachleute aus Industrie, Wissenschaft und
Forschung zusammen. Die mittlerweile etablierte Konferenz ist die
geeignete Plattform, um die neuesten Entwicklungen und Anwendungen der
Lasertechnologie für die Brennstoffzellen- und Wasserstoffproduktion zu
diskutieren. Fokus der zweitägigen Veranstaltung im Fraunhofer-Institut
für Lasertechnik ILT in Aachen lag auf der kontinuierlichen Fertigung von
metallischen Bipolarplatten, der Prozessüberwachung und der
Funktionalisierung von Oberflächen.
»Die Lasertechnologie bietet uns die Möglichkeit, die Herausforderungen
der Wasserstoffwirtschaft auf eine nachhaltige und effiziente Weise zu
meistern«, erklärte Dr. Alexander Olowinsky, Leiter der Abteilung Fügen
und Trennen am Fraunhofer ILT und Gastgeber der Veranstaltung. »Die
Lasertechnologie ist der Schlüssel, um innovative Lösungen für die
industrielle Fertigung von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren zu
entwickeln.«
Die 17 Vorträge des diesjährigen LKH2 erörterten verschiedene Aspekte der
industriellen Produktion von Brennstoffzellen und den Einsatz von
Lasertechnologien entlang der gesamten Prozesskette. Tobias Keller vom
Fraunhofer ILT erläuterte in seinem Vortrag die Vorteile der
Laserstrahlung beim Bearbeiten und Strukturieren von Bipolarplatten, um
die Effizienz und die Haltbarkeit dieser Bauteile zu maximieren. »Die
Strukturierung und Optimierung von Bipolarplatten sind entscheidende
Schritte auf dem Weg zu leistungsfähigeren und kosteneffizienteren
Brennstoffzellen.« Keller verdeutlichte die Bedeutung der Rolle-zu-Rolle-
Fertigung, bei der Materialien effizienter und kostengünstiger verarbeitet
werden können.
Prof. Dr. Eike Hübner vom Fraunhofer-Heinrich-Hertz-Inst
demonstrierte, wie laserinduzierte Nanostrukturen die Oberflächen von
Brennstoffzellen erheblich verbessern können, beispielsweise als Nano-
Schäume. Diese Nanoformen haben eine hohe Porosität und eine große
Oberflächenvergrößerung, was sie für verschiedene Anwendungen interessant
macht. »Laser induced Nano Forms bieten eine signifikante
Oberflächenvergrößerung um den Faktor 3000 im Vergleich zu herkömmlichen
Strukturen,« so der Professor.
Laserbasierte Prozesse als Treiber für die Wasserstofftechnologie
Ultrakurzpuls-Laser, mit denen solche Nanostrukturen hergestellt werden
können, bieten weitere beachtliche Chancen. Stoyan Stoyanov vom Fraunhofer
ILT erläuterte, wie sich mit UKP-Lasern komplexe Schnittkonturen in
Bipolarplatten (BPP) realisieren lassen, wie etwa Gas- und Kühlwasserein-
und -auslässe. Dr. Steffen Berger von der Schaeffler AG konzentrierte sich
in seinem Vortrag ebenfalls auf die Laserbearbeitung metallischer BPP mit
UKP-Lasern. Sie ermöglichen eine präzise Bearbeitung filigraner Strukturen
im µm-Bereich mit minimaler Materialveränderung und hoher
Wiederholgenauigkeit.
Dr. Martin Müller vom Forschungszentrum Jülich betonte die Bedeutung der
Elektrolyse im Wasserstoffproduktionsprozess und stellte heraus, dass der
Schlüssel zur Effizienzsteigerung in der Verbesserung der verwendeten
Materialien liegt. Er erläuterte die Entwicklung neuer
Elektrodenstrukturen und deren Katalysatoren, die in der Elektrolyse und
in Brennstoffzellen zum Einsatz kommen.
Der Vortrag von Dr. Simon Britten von Laserline zeigte, wie Diodenlaser
effizienter und präziser für verschiedene industrielle Prozesse eingesetzt
werden können, insbesondere in der Elektrolyse und in der Produktion von
Brennstoffzellen. »Wir erreichen mit Lasertechnologie eine
Energieeinsparung beim Trocknen im Bereich von 20 bis 30 Prozent bei den
Betriebskosten.«
Grenzüberschreitende Netzwerke für die Wasserstoffwirtschaft
Ein wichtiger Bestandteil der Konferenz war der Austausch über
internationale Kooperationen, die für die Weiterentwicklung der
Wasserstofftechnologie unverzichtbar sind. Dr. Dina Barbian vom eco2050
Institut für Nachhaltigkeit betonte in ihrem Vortrag die Notwendigkeit
einer globalen Zusammenarbeit, um die Herausforderungen einer nachhaltigen
Wasserstoffproduktion zu bewältigen. Sie betonte die Bedeutung von
Kooperationen zwischen Ländern mit unterschiedlichen Ressourcen, um sowohl
Wasserstoffproduktion als auch Transportinfrastrukturen effizienter zu
gestalten.
Ein gutes Beispiel für internationale Zusammenarbeit stellte Robert
McConville der Hysata Pty Ltd aus Unanderra, Australien, vor. Er war live
aus Downunder zugeschaltet: Das Unternehmen will nach eigenen Angaben
künftig mit ihren Kapillarelektrolyseuren den weltweit kostengünstigsten
grünen Wasserstoff liefern. »Dieses Projekt zeigt die Bedeutung
internationaler Zusammenarbeit, um große technologische Herausforderungen
zu bewältigen«, betonte McConville. Solche Kooperationen fördern nicht nur
technologische Innovationen, sondern treiben auch den Aufbau von
Infrastrukturen für Produktion, Transport und Speicherung von Wasserstoff
weltweit voran.
Innovationen für die industrielle Brennstoffzellenfertigung
Welche Fortschritte der Transport und vor allem die Speicherung von
Wasserstoff macht, erläuterte Heiko Baumann vom Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT. Auch Dr. Michael Rhode von der Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung, Berlin, sprach über die
Herausforderungen bei der Herstellung von Elektrolyseuren,
Brennstoffzellen, Speicher- und Verteilungssystemen. »Wasserstoff hat ganz
eigene Anforderungen an Materialien, besonders hinsichtlich
Korrosionsbeständigkeit und Temperaturwechsel.«
Dr. Benjamin Hertweck von Hugo Kern und Liebers sprach über Laserschweißen
und Stanztechniken zur Effizienzsteigerung in der Herstellung von
Brennstoffzellen. Richard Steinbrecht von Lessmüller Lasertechnik aus
München unterstrich in seinem Vortrag die Wichtigkeit, Laserprozesse
kontinuierlich zu überwachen, um Fehler in der Produktion frühzeitig zu
erkennen. »Es kommt am Ende des Tages auf die Präzision der Bipolarplatte
an«, bekräftigte Stefan Kaiser von der ANDRITZ Kaiser GmbH.
Durch präzise und effiziente Laserschweißtechniken lassen sich Qualität
und Konsistenz der Verbindungen verbessern, was besonders bei den
filigranen Strukturen der BPP wichtig ist. Bereits kleinste Fehler in der
Fertigung können zu einer signifikanten Beeinträchtigung der Leistung
führen. »Fehler wie Schmelzanhäufungen entlang der Schweißnaht sind bei
hohen Geschwindigkeiten häufiger – durch Process Monitoring können wir
diese frühzeitig erkennen und beheben«, machte Elie Haddad vom Fraunhofer
ILT deutlich.
Labor für praxisorientierte Forschung und Industriekooperationen
Nachdem es am Dienstagvormittag bereits Laborführungen im Fraunhofer ILT
gab, erkundeten die Teilnehmenden am Nachmittag das HydrogenLab. Das
Laserinstitut hat dort optimale Bedingungen geschaffen, um die
Brennstoffzelle von den Grundlagen bis zur Serienreife zu entwickeln. Das
praxisorientierte Umfeld des HydrogenLab ist auf interdisziplinäre
Zusammenarbeit ausgelegt und bietet optimale Bedingungen für öffentliche
Projekte und Industriekooperationen.
»Einmal mehr hat das diesjährige LKH2 gezeigt, dass die Zusammenarbeit
zwischen Instituten und Unternehmen gerade für die Abbildung der gesamte
Fertigungs- und Prozesskette in der Wasserstofftechnologie essentiell
ist,« resümiert Alexander Olowinsky. »Dabei spielen die Laserprozesse von
der Werkzeugtechnik über das Schneiden und Schweißen bis zu
Oberflächenfunktionalisierung auch und gerade unter energetischen
Gesichtspunkten eine entscheidende Rolle. Ich freue mich jetzt schon auf
Berichte zu Fortschritten und neuen Anwendungen im kommenden Jahr.«
- Aufrufe: 20