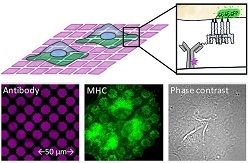Absolventin des Fernstudiums MBA Logistik – Management & Consulting erhält Koblenzer Hochschulpreis

Feierliche Koblenzer Hochschulpreisverleihung der Wirtschafts- und
Wissenschaftsallianz e.V.
In einer Feierstunde hat die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz
e. V (WWA) den diesjährigen Koblenzer Hochschulpreis für akademische
Spitzenleistungen verliehen. Für das zfh – Zentrum für Fernstudien im
Hochschulverbund erhielt Stefanie Müller die Auszeichnung für ihre
hervorragende Master-Thesis im Fernstudiengang Logistik – Management &
Consulting mit international anerkanntem MBA-Abschluss. Das Fernstudium
führt die Hochschule Ludwigshafen in Kooperation mit dem zfh durch.
In ihrer von Prof. Dr. Andreas Gissel betreuten Thesis untersuchte
Stefanie Müller die „Anwendung des Warehouse-Location-Problems zur
strategischen Entscheidung“. Ziel der Arbeit war es, zu prüfen, ob das
Modell ein theoretisches Konstrukt darstellt oder ob eine praktische
Anwendung ableitbar ist. Hierzu wurde zunächst geprüft, welche Varianten
des Modells bisher in der Fachliteratur erfasst sind und wie sich diese
auf in der Realität bestehende Distributionssysteme adaptieren lassen.
Stefanie Müller ging zunächst dem Ziel des Modells nach, nämlich unter
Berücksichtigung minimaler Kosten zu entscheiden, welches
Distributionszentrum welche Kunden beliefert. Die Herausforderung dabei
war, dass praktische Anwendungen in der Literatur nur selten beschrieben
werden. Müller kam zu dem Ergebnis, dass das Modell sehr flexibel sei und
sich einfach auf unterschiedliche Bedürfnisse anpassen ließe.
Die Koblenzer Hochschulpreisverleihung fand zum 26. Mal statt und stellt
jedes Jahr aufs Neue die leistungsstarke Hochschullandschaft der Region
Koblenz unter Beweis. Damit trügen die Hochschulen zur Fachkräftesicherung
bei und dienten durch einen gezielten Wissens- und Technologietransfer in
Wirtschaft und Gesellschaft als Motor für regionale Innovationen
unterstrich Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, aktueller Vorsitzender
der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz e. V und Präsident der
Hochschule Koblenz. Die Hochschule Koblenz war in diesem Jahr für die
Organisation der Veranstaltung mitverantwortlich. Die Sparkasse Koblenz
über ihre "Stiftung Zukunft" sowie die Kreissparkasse Mayen haben wieder
die Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 € zur Verfügung gestellt.
Acht junge Akademikerinnen und Akademiker von Hochschulen aus der Region
sowie vom zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund sind im
Rahmen einer Festveranstaltung im Historischen Ratssaal des Koblenzer
Rathauses für ihre herausragenden Leistungen im Studium ausgezeichnet
worden. Diesmal fand die Präsentation der prämierten Abschlussarbeiten in
einem neuen Format statt: Moderator Sebastian Messerschmidt führte durch
die Veranstaltung und stellte die acht Preisträgerinnen und Preisträger
dem Publikum in Interviews vor.
Abschließend lud Oberbürgermeister David Langner alle Gäste zu einem
Imbiss ein, den die Gäste auch rege zum Gedankenaustausch und zum
Vertiefen ihrer Netzwerke nutzten.
Über das zfh
Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund ist eine zentrale
wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in
Koblenz. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages der Bundesländer
Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland kooperiert es seit 1998 mit den 13
Hochschulen der drei Länder und bildet mit ihnen gemeinsam den zfh-
Verbund. Darüber hinaus kooperiert das zfh mit weiteren Hochschulen aus
Bayern, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Das erfahrene Team
des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und
Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 70
berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen,
technischen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-
Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen
mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem
akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den
Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA
zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und
Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an
Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind nahezu 6.200
Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.
- Aufrufe: 190