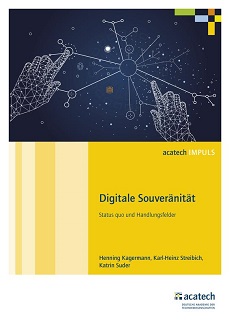Neue MBA-Studienangebote an der Ostfalia
An der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften starten zum Wintersemester 2021/22 zwei MBA-
Studienangebote.
Am Campus Salzgitter der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
starten zum Wintersemester 2021/22 gleich zwei neue MBA-Programme (Master
of Business Administration). Es handelt sich dabei um die MBA-Studiengänge
„Stadtmarketing“ und „Management gesellschaftlicher Innovationen“ an der
Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien
Fernstudiengänge mit Präsenzphasen im Blended-Learning-Format angeboten.
Die Studiengänge arbeiten intensiv mit berufsständigen Organisationen und
potenziellen Arbeitgebern zusammen. „Insbesondere die intensive
Kooperation mit Städten, Kommunen und Firmen fördert gewinnbringende
Synergien, da flexibel sowohl auf die Bedürfnisse der Studierenden als
auch gleichermaßen auf die Anforderungen der Arbeitswelt eingegangen
werden kann“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Andreas Jain.
Die Konzeption des MBA-Studiengangs „Stadtmarketing“ ist in enger
Abstimmung mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland
e.V. (bcsd) erfolgt, die mit weit über 400 Mitgliedern den Berufsstand
vertritt. Gemeinsam haben Praxis und Wissenschaft die Anforderungen an
einen zukunftsfähigen Studiengang definiert, sodass künftigen
Führungskräften fachspezifisches Know-how, wie kommunale Strukturen,
strategisches Stadtmarketing oder städtische Infrastruktur vermittelt
werden. Aber auch General Management Skills, wie Projektmanagement oder
Management-Techniken, sind Bestandteil des Studienplans.
Der MBA-Studiengang „Management gesellschaftlicher Innovationen“ wurde
gemeinsam mit der Fakultät Wirtschaft der Ostfalia Hochschule entwickelt
und wird in Kooperation beider Fakultäten mit abwechselnden Präsenzphasen
in Wolfsburg und Salzgitter durchgeführt. Der Studiengang greift aktuelle
Fragestellungen auf, die gesellschaftliche Veränderungsprozesse mit sich
bringen. Er vermittelt aber auch wichtiges Hintergrundwissen zu Themen wie
Klimafolgen, Innovationskultur und Managementdiagnostik.
Weitere Informationen zu den neuen MBA-Studiengängen sowie der Anmeldung
zur Online-Vorstellung am 28. April und 3. Juni unter: www.ostfalia.de/gi
und www.ostfalia.de/stm.
- Aufrufe: 3