Digitale Souveränität: acatech IMPULS entwirft Schichtenmodell als Handlungsrahmen für die EU
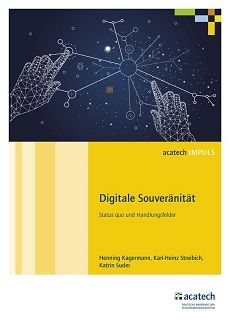
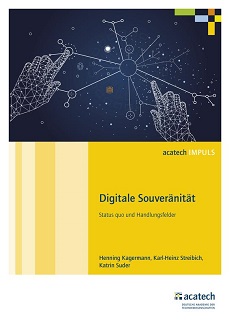
Es sei an der Zeit, dass die EU ihre digitale Souveränität stärkt,
schrieben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Amtskolleginnen kürzlich in
einem offenen Brief. Doch wie lässt sich das komplexe Ziel in konkrete
Handlung übersetzen? Der heute erschienene IMPULS „Digitale Souveränität“
von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften schafft den
Rahmen: Ein neues Schichtenmodell unterscheidet acht Ebenen digitaler
Souveränität, anhand derer sich punktgenaue Handlungsoptionen ergeben.
Die Corona-Krise hat wie unter einem Brennglas den Nutzen digitaler
Anwendungen verdeutlicht. Sie hat aber auch gezeigt, wie wichtig digitale
Souveränität wird: Plattformen für Online-Meetings ermöglichen den Kontakt
auf Abstand, werfen aber auch Datenschutzfragen auf. Digitale
Unterrichtsangebote sind gefragter denn je, doch auch hier gibt es
Streitpunkte im Hinblick auf die Zuverlässigkeit und den Schutz der
Privatsphäre. Der Austausch von medizinischen Daten in Echtzeit ist
wichtiger denn je, doch immer noch werden viele Informationen mit Papier,
Stift, Drucker und Faxgerät ausgetauscht. Quer durch alle
Anwendungsbereiche dominieren Plattform- und Cloud-Anbieter außerhalb der
EU.
„Digitale Souveränität ist nicht nur eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit,
sondern auch der politischen Selbstbestimmtheit der Europäischen Union und
ihrer Mitgliedsstaaten“, schreiben die Herausgeber des nun vorliegenden
acatech IMPULSES „Digitale Souveränität“: Karl-Heinz Streibich, Henning
Kagermann und Katrin Suder. „Die Idee einer Digitalen Souveränität
europäischer Prägung zielt auf eine Digitalisierung, die Wahlfreiheit
lässt, die europäischen Rechts- und Wertevorstellungen folgt, die sich der
Welt öffnet und fairen Wettbewerb fördert.“
Die Autorengruppe spricht sich in ihrem Impuls klar gegen Protektionismus
aus. Das wichtigste Element digitaler Souveränität sei
Gestaltungsfreiheit. Eine freie Gesellschaft mitsamt ihrer öffentlichen
Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen müsse frei wählen können,
welche digitalen Technologien, Dienste oder Anbieter sie nutzt. Wo diese
Wahlfreiheit in Frage steht oder fehlt, müsse sie behauptet werden.
Die wichtigsten Hebel zur Behauptung digitaler Souveränität sind dem
Impulspapier zufolge Investitionen (am besten in die jeweils nächste
Generation digitaler Technologie), das Aufbrechen von Lock-in-Effekten
(also der Bindung an ein digitales Angebot durch Hürden beim
Anbieterwechsel) und europäisches Wachstum in strategisch wichtigen
Bereichen. Für die genaue Analyse von Stärken, Schwächen und sinnvollen
Handlungsmöglichkeiten entwirft das Impuls-Papier ein Schichtenmodell mit
acht Ebenen: Ausgehend von zugrundeliegenden Rohmaterialien und
Komponenten über Kommunikationsinfrastrukturen und Cloud-Plattformen, bis
hin zu europäischen Datenräumen, Softwaretechnologien und dem
rahmengebenden europäischen Rechts- und Wertesystem.
Für jede dieser acht Schichten analysiert der acatech IMPULS exemplarisch
kritische Bereiche. Eine der Schichten sind die Komponenten digitaler
Geräte und Infrastrukturen. Politischer Handlungsbedarf bestehe auf dieser
Ebene vor allem im Bereich Mikrochips. Der Grad an Abhängigkeiten von
Wirtschaftsräumen jenseits der EU sei hoch. Daraus ergeben sich
Verwundbarkeiten, die im ersten Quartal des Jahres 2021 durch eine
konkrete Mangelsituation in zahlreichen Branchen deutlich sichtbar wurden.
Auf Ebene der Datenräume konstatiert die Expertengruppe: Im B2C-Bereich
(Angebote für Privatnutzer) dominieren bereits digitale Plattformen aus
den USA und China. Innerhalb der B2C-Datenräume gehe es um europäische
Regulationshoheit (im Sinne eines europäischen Digital Service Acts als
Antwort auf den US Cloud Act) sowie Governance-Hoheit, also die
Durchsetzung europäischer DSVGO-Standards gegenüber Anbietern außerhalb
der EU. Bei den Datenräumen im gewerblichen und öffentlichen Bereich (B2B)
sei der Wettbewerb dagegen noch offen. Ihr Aufbau muss dem Impuls-Papier
zufolge daher politisch begleitet und gefördert werden. Ausgangspunkte
seien die GAIA-X Initiative und die International Data Spaces (IDS).
Beispielgebend könne der Datenraum Mobilität werden, den acatech gemeinsam
mit der Bundesregierung sowie privaten und öffentlichen Mobilitätsanbieter
derzeit aufbaut.
Die Autorengruppe konstatiert: Sollte es digitalen außereuropäischen
Hyperscalern gelingen, neben ihrer Dominanz in den Konsumentenplattformen
auch in den industriellen Datenräumen eine vorherrschende Position zu
erlangen, hätte dies gravierende wirtschaftliche Konsequenzen und würde
die Spielräume digitaler Souveränität empfindlich einschränken. Die
Ausgangsposition ist nach den Worten von Karl-Heinz Streibich besser als
oft behauptet: „Wenn Deutschland und die Europäische Union die
Handlungsfelder digitaler Souveränität strategisch und konzertiert
angehen, haben wir gute Chancen auf einen selbstbestimmten Weg in die
Digitalisierung. Denn in der anstehenden Phase der Digitalisierung fällt
es industriell geprägten Unternehmen leichter, sich zu digitalisieren, als
dass es Digitalunternehmen gelingt, industrielle Wertschöpfung
nachzuvollziehen.“






