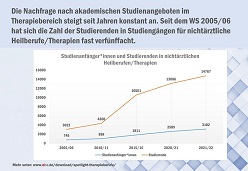Elektromobilität: Logistikfuhrparke bieten gesicherte Flexibilität und können Stromnetze entlasten
Elektrische Fuhrparke der Logistikbranche bieten eine
gesicherte Flexibilität für das Stromnetz. Zusammen mit netzdienlichen
Ladestrategien können sie helfen, Engpässe oder Überlastungen in
Verteilnetzen zu vermeiden und Strom aus Erneuerbaren Energien flexibler
zu nutzen. Zu diesen Ergebnissen kommt das Team des Projekts Netz_eLOG.
Darin haben das Reiner Lemoine Institut (RLI), IAV und die E.DIS Netz GmbH
am Beispiel eines Fuhrparks der Deutschen Post in Kleinmachnow
Auswirkungen der Elektromobilität auf das Stromnetz untersucht.
In einem Praxistest mit 30 Elektrofahrzeugen (StreetScooter) der Deutsche
Post AG hat das Konsortium analysiert, wie die Flotte als flexible Last
für einen effizienten Betrieb des Verteilnetzes der E.DIS genutzt werden
kann. Dafür wurden betriebliche Anforderungen des Logistikunternehmens
berücksichtigt, wie Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Die
Ergebnisse zeigen: Mithilfe netzdienlicher Ladestrategien kann der
Stromverbrauch von Fahrzeugen an eine schwankende Einspeisung Erneuerbarer
Energien angepasst werden. Das hilft zum Beispiel, einspeisebedingte
Belastungsspitzen im Stromnetz zu reduzieren. Simulationen für geeignete
Netzgebiete ergaben außerdem, dass bis zu einem Viertel des Ladestroms für
einen vergleichbaren Fuhrpark durch Strom aus Erzeugungsanlagen
bereitgestellt werden könnte, die ohne diese Strategie abgeregelt worden
wären.
„Aktuelle Vorschläge der EU-Kommission für ein Reduktionsziel von 90
Prozent weniger CO2 im Bereich Nutzfahrzeuge bis 2040 werden den Hochlauf
der Elektromobilität weiter antreiben. Unser Projekt zeigt, dass gerade im
Logistikbereich netzdienliche Ladestrategien die Energiewende unterstützen
können. Wir sehen außerdem, dass netzdienliches Laden unter den richtigen
Rahmenbedingungen Kosten für Flotten- und Netzbetreiber reduzieren kann.
Dafür gilt es nun, die Netzentgelte als Anreizsystem weiterzuentwickeln“,
sagt Jakob Gemassmer, Leiter des Projekts und wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Forschungsbereich Mobilität mit Erneuerbaren Energien am
RLI.
Fahrzeugflotte als große Batterie
Das Projektteam hat herausgefunden, dass E-Fahrzeuge einer Flotte mit
ähnlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten Verteilnetzbetreibern eine
gesicherte Flexibilität anbieten können. Solche Fuhrparke sind in der
Lage, innerhalb einer klaren Standzeit konkrete Leistungsvorgaben des
Netzbetreibers umzusetzen. Die Flotte dient dabei als große stationäre
Batterie. Ihre Flexibilität als mobiler Speicher bleibt immer auf die
Standzeiten der Fahrzeuge begrenzt.
Erfolgreiche netzdienliche Steuerung
Im Praxistest konnte E.DIS direkt aus der Leitstelle Steuersignale für die
Ladevorgänge des Fuhrparks senden und so zum Beispiel einen gewünschten
Ladefahrplan im Projekt umsetzen. Voraussetzung dafür war eine von IAV
entwickelte IoT-Plattform als Software as a Service-Anwendung. Dort waren
unter anderem Ladepunkte, Leistungsmesswerte und die Leitstelle für den
Netzbetrieb angebunden. Die Werte zum Standort und den Fahrzeugen, wie zum
Beispiel Energieverbrauch und Abfahrzeit dienten als Eingangsgrößen für
die Steuerung. Mit der Anwendung und entsprechenden Daten hat das
Projektteam Ladepläne für die Zukunft erzeugt und aus vergangenem
Ladeverhalten gelernt.
Grundlage für die sichere Nachrichtenübertragung zur Ladesäule bildete das
Open Charge Point Protokoll. Diese interoperable Kommunikation mit den
Ladepunkten und die Anbindung an die Leitstelle des Netzbetreibers sind
Voraussetzungen für die Nutzung netzdienlicher Flexibilität.
Open-Source-Modell für Ladestrategien entwickelt
Analysen in verschiedenen Netzgebieten und für weitere Anwendungsfälle
ergeben ähnliche Ergebnisse wie der Praxistest mit DHL. Das RLI hat zu
diesem Zweck SpiceEV, ein Open-Source-Modell zur Simulation und Analyse
von Ladestrategien entwickelt. Damit wurden weitere Fuhrparke aus den
Bereichen Logistik, Handel oder Dienstleistung untersucht.
Über das Projekt: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
fördert das Projekt im Zeitraum November 2019 bis März 2023. Die
Ergebnisse wurden am 10. März in Potsdam vorgestellt. Mehr Informationen
zum Projekt gibt es hier: https://reiner-lemoine-institu
netzintegration-e-mobilitaet/
Mehr Informationen zum Thema Netzintegration der Elektromobilität am RLI
gibt es hier: https://reiner-lemoine-institu
netzintegration-emobilitaet/
Über das RLI: Das Reiner Lemoine Institut (RLI) ist ein unabhängiges,
gemeinnütziges Forschungsinstitut, das sich seit 2010 für eine Zukunft mit
100 Prozent Erneuerbaren Energien einsetzt. Die Wissenschaftler*innen des
RLI forschen anwendungsorientiert und wissenschaftlich für die Energie-
und Verkehrswende in Deutschland und international. Seit der Gründung
haben sich die am Institut entwickelten Open-Source-Modelle fest in der
Energiesystemmodellierung etabliert. Die Mobilitäts- und
Elektrifizierungskonzepte des RLI werden von Unternehmen und der
öffentlichen Hand weltweit umgesetzt.
Über E.DIS: Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der
größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands. Mit etwa 2.500
Mitarbeitenden einschließlich rund 170 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe
einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern. Die E.DIS investiert
jedes Jahr weit über 100 Millionen Euro in ihre Netze, die eine
Leitungslänge von rund 80.000 Kilometern haben. Circa 1,3 Millionen
Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe in Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern sind an dieses Netz angeschlossen.
Über IAV: Als einer der global führenden Engineering- und
Technologiepartner der Automobilindustrie entwickelt IAV die digitale
Mobilität der Zukunft. Das Unternehmen entwickelt seit 40 Jahren
innovative Konzepte, Methoden und Lösungen, und hat 2022 einen Umsatz von
837 Mio. Euro erwirtschaftet. Mit 7.600 Mitarbeitenden bringt IAV das
Beste aus unterschiedlichsten Welten zusammen: Automotive- und IT-Welt,
Hard- und Software-Welt sowie Produkt- und Servicewelt. Neben der
Fahrzeug- und Antriebsentwicklung hat das Unternehmen bereits frühzeitig
auf Themen, wie beispielsweise E-Mobilität und autonomes Fahren gesetzt
und ist heute einer der führenden Technologieanbieter auf diesen Gebieten.
- Aufrufe: 2