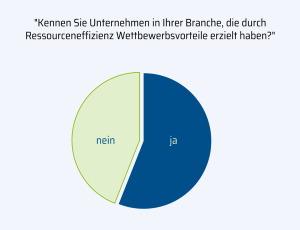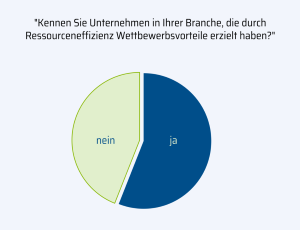Die aktuelle Metaanalyse eines internationalen Netzwerks, an dem auch die
Universität Duisburg-Essen beteiligt ist, zeigt, dass Triptane am
effektivsten gegen akute Migräneattacken wirken. Auch neuere
Migränemedikamente waren nicht überlegen. Dennoch nehmen nur gut sieben
Prozent der Betroffenen Triptane ein – trotz hoher Wirksamkeit, allgemein
guter Verträglichkeit und relativ geringer Therapiekosten. Die Deutsche
Gesellschaft für Neurologie appelliert an Ärztinnen und Ärzte, Betroffene
adäquat zu informieren und diese Substanzklasse breiter einzusetzen.
Die Migräne ist die mit Abstand häufigste neurologische Erkrankung. Nach
Erhebungen des Robert Koch-Instituts leiden 14,8 % der Frauen und 6 % der
Männer in Deutschland unter einer Migräne [1]. Bei Migräne kommt es zu
Attacken von heftigen, meist halbseitigen, pulsierenden und pochenden
Kopfschmerzen. Oft werden diese von Übelkeit, Erbrechen, Licht-, Lärm- und
Geruchsüberempfindlichkeit und einem allgemeinen Krankheitsgefühl
begleitet. Die Migräneattacken können zwischen vier und 72 Stunden
anhalten. Viele Betroffene erleiden mehrmals im Monat Migräneattacken, die
Erkrankung ist daher mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Für die
Lebensqualität ist es daher von hoher Wichtigkeit, dass die Attacken
schnell und wirksam bekämpft werden können.
Es gibt eine Reihe von Medikamenten zur Behandlung von akuten
Migräneattacken. Dazu gehören einfache, freiverkäufliche Schmerzmittel wie
Acetylsalicylsäure oder Paracetamol oder nichtsteroidale Antirheumatika
wie Ibuprofen, Diclofenac oder Naproxen. Es gibt aber auch spezielle
Migränemittel, die gezielt zur Behandlung akuter Migräneattacken
entwickelt wurden. Dazu gehören die sogenannten Triptane, eine
Wirkstoffgruppe, von der sieben verschiedene Substanzen in Europa zur
Behandlung akuter Migräneattacken zugelassen und verfügbar sind
(Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan,
Sumatriptan und Zolmitriptan). In den letzten Jahren wurden zusätzlich
neue Migränemittel entwickelt: Lasmiditan wirkt ebenfalls bei
Migräneattacken und hat gegenüber Triptanen den Vorteil, dass es keine
gefäßverengenden Nebenwirkungen hat. Neu entwickelt wurden auch die
sogenannten Gepante (Rimegepant, Ubrogepant), die gezielt an einem
Rezeptor (CGRP) andocken, der im Bereich des Gesichtsnervs (Nervus
trigeminus) und im Gehirn bei der Entstehung von Migräneattacken eine
wichtige Rolle spielt.
Es gibt eine Vielzahl von Studien, bei denen Schmerz- und Migränemittel
mit Placebos (Scheinmedikamenten) oder anderen Schmerz- und Migränemitteln
verglichen wurden. Eine Arbeitsgruppe von
Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern und Klinikerinnen/Klinikern der
Universitäten in Oxford (UK), der Universität Kopenhagen (Dänemark),
Harvard Medical School, Boston (USA) und der Universität Duisburg-Essen
hat jetzt erstmalig einen großen Vergleich der Schmerz- und Migränemittel
zur Behandlung akuter Migräneattacken durchgeführt. Die Studie [2] wurde
aktuell in der renommierten Zeitschrift British Medical Journal (BMJ)
publiziert.
Die Netzwerk-Metaanalyse hat die Ergebnisse von 137 randomisierten und
kontrollierten Studien mit insgesamt 89.445 Patientinnen und Patienten
ausgewertet, in denen 17 verschiedene Medikamente oder Placebos zur
Therapie von akuten Migräneattacken eingesetzt wurden. Für die Wirksamkeit
wurde herangezogen, wie viele Patientinnen und Patienten zwei Stunden nach
Einnahme des entsprechenden Medikaments vollständig schmerzfrei waren. Ein
weiteres Erfolgskriterium war der Prozentsatz derjenigen, bei denen sich
die Kopfschmerzen in den zwei Stunden nach Einnahme deutlich besserten.
Die Besserung war definiert als ein Rückgang von schweren oder
mittelschweren Kopfschmerzen zu leichten oder keinen Kopfschmerzen.
Daneben wurden auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen erfasst.
Als Referenzsubstanz für diese große Metaanalyse diente Sumatriptan, das
Triptan, das in der Gruppe der Triptane in Deutschland mit großem Abstand
am häufigsten verschrieben wird. Für den Endpunkt „schmerzfrei nach zwei
Stunden“ war das wirksamste Medikament Eletripan, gefolgt von Rizatriptan,
Zolmitriptan und Sumatriptan. Die neueren Migränemittel Lasmiditan und
Gepante waren diesbezüglich weniger wirksam als die Triptane. Ihre
Wirksamkeit war vergleichbar mit Acetylsalicylsäure oder nichtsteroidalen
Antirheumatika. Am wenigsten wirksam war Paracetamol. Im Hinblick auf den
Endpunkt „Besserung der Kopfschmerzen nach zwei Stunden“ waren Triptane
ebenfalls überlegen. Sie waren wirksamer als die neuen Migränemittel und
die traditionellen Schmerzmittel.
Die herkömmlichen Schmerzmedikamente schnitten in dieser Erhebung
bezüglich der Nebenwirkungen etwas besser ab. „Allerdings muss bei den
Nebenwirkungen berücksichtigt werden, dass Symptome wie Übelkeit,
Müdigkeit oder Benommenheit auch Beschwerden im Rahmen der eigentlichen
Migräneattacke sein können, die manchmal nur dann von den Betroffenen
wahrgenommen werden, wenn sich die Kopfschmerzen durch die Behandlung
verbessert haben“, erklärt Migräne-Experte und Ko-Autor der Studie Prof.
Dr. Hans Christoph Diener. „Einzige wirkliche Limitation stellt die
gefäßverengende Eigenschaft von Triptanen dar. Die Verschreibung ist daher
bei arteriellen Gefäßerkrankungen kontraindiziert.“
Was sind nun die praktischen Konsequenzen für die Behandlung von
Migränepatientinnen und -patienten in Deutschland?
Die Daten einer repräsentativen bevölkerungsbezogenen Studie in
Deutschland des Robert Koch-Instituts aus dem Jahr 2020 [1] zeigten, dass
lediglich 7,3 % der Betroffenen bei Migräneattacken die wirksamsten
Medikamente einnahmen, nämlich ein Triptan. Die meisten (46 %) behandeln
ihre Migräneattacken mit Ibuprofen, 17 % mit Paracetamol und 10 % mit
Acetylsalicylsäure. „Die Tatsache, dass Triptane so selten eingesetzt
werden, kann auch nicht mehr darauf beruhen, dass sie teuer sind. In der
Zwischenzeit sind alle Triptane nach Ablauf des Patentschutzes als
Generika erhältlich, einige sogar ohne Rezept“, erklärt Prof. Diener.
„Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Metaanalyse ist, dass wir in
Deutschland deutlich mehr Migränepatientinnen und -patienten mit den sehr
wirksamen und sicheren Triptanen behandeln sollten. Dies gilt
insbesondere für die, bei denen Schmerzmittel wie Paracetamol oder nicht-
steroidale Antirheumatika nicht oder nicht ausreichend wirksam sind. Eine
Information, die für Betroffene, aber auch die Ärzteschaft relevant ist,“
erklärt DGN-Generalsekretär Prof. Dr. Peter Berlit.
[1] Porst M, Wengler A, Leddin J, Neuhauser H, Katsarava Z, von der Lippe
E, et al. Migraine and tension-type headache in Germany. Prevalence and
disease severity from the BURDEN 2020 Burden of Disease Study. Journal of
Health Monitoring. 2020; 5(S6): 2–24.
[2] Karlsson WK, Ostinelli EG, Zhuang ZA et al. Comparative effects of
drug interventions for the acute management of migraine episodes in
adults: systematic review and network meta-analysis. BMJ 2024 Sep 18; 386:
e080107. doi: 10.1136/bmj-2024-080107. PMID: 39293828.
https://www.bmj.com/content/bmj/386/bmj-2024-080107.full.pdf
Pressekontakt
Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
Pressesprecher: Prof. Dr. med. Peter Berlit
Leiterin der DGN-Pressestelle: Dr. Bettina Albers
Tel.: +49(0)30 531 437 959
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN)
sieht sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft in der
gesellschaftlichen Verantwortung, mit ihren mehr als 12.300 Mitgliedern
die neurologische Krankenversorgung in Deutschland zu sichern und zu
verbessern. Dafür fördert die DGN Wissenschaft und Forschung sowie Lehre,
Fort- und Weiterbildung in der Neurologie. Sie beteiligt sich an der
gesundheitspolitischen Diskussion. Die DGN wurde im Jahr 1907 in Dresden
gegründet. Sitz der Geschäftsstelle ist Berlin. www.dgn.org