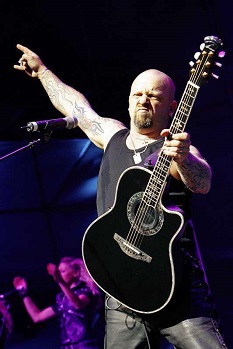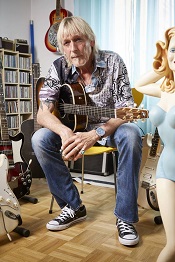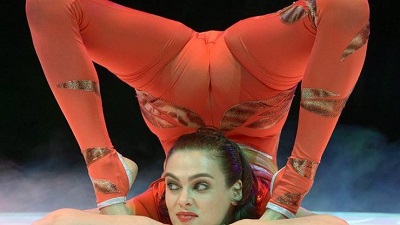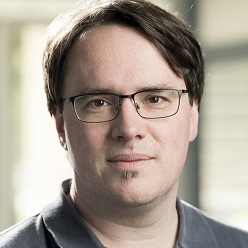HTWK Leipzig baut „Angewandte Digitalisierung“ aus Landeshaushalt sieht zusätzliche Professuren für ein neues Querschnittsprofil vor

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK
Leipzig) werden die bestehenden Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung
weiter ausgebaut: Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen
Landtages hat beschlossen, zwei neue, zusätzliche Professuren für das
geplante Querschnittsprofil „Angewandte Digitalisierung“ an der HTWK
Leipzig einzurichten. Diese Professuren werden aus Haushaltsmitteln
finanziert und sollen Themen an den Schnittstellen zwischen
Digitalisierung und den bestehenden anwendungsbezogenen Fachgebieten der
HTWK Leipzig entwickeln.
An der HTWK Leipzig sind aktuell 6.186 Studierende eingeschrieben, mehr
als drei Viertel in einem ingenieur- oder informationswissenschaftlichen
Fach wie Informatik, Bauwesen, Maschinenbau, Energietechnik,
Elektrotechnik, Informationstechnik oder Medientechnik.
Zudem wird sich die Deutsche Telekom AG in einem bundesweit einmaligen
Umfang an der HTWK Leipzig engagieren, um Lehre, Forschung und Transfer im
Themenfeld der Digitalisierung zu stärken. Geplant ist die Einrichtung
mehrerer Studiengänge an einer Fakultät „Digitale Transformation“ mit
perspektivisch 500 Studierenden.
Prof. Gesine Grande, Rektorin der HTWK Leipzig: „Die HTWK Leipzig ist
bereits jetzt eine der forschungsstärksten Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften (HAW) in Deutschland und die am stärksten von Studierenden
nachgefragte HAW in Sachsen. Unsere Hochschule ist das
ingenieurwissenschaftliche Zentrum der Region; unsere Professoren,
Mitarbeiter und unsere Studierenden ein wichtiger Standortvorteil für
Leipzig. Dieser Rolle werden wir mit dem neuen Querschnittsprofil
„Angewandte Digitalisierung“ künftig noch besser gerecht. Digitalisierung
ist ein Querschnittsthema – in Verbindung mit unseren bestehenden
vielfältigen technischen Fächern und mit den Bereichen Wirtschaft,
Soziales und Kultur können wir Impulse für die Umsetzung der digitalen
Transformation hier in der Region setzen.“
Aline Fiedler, hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion:
„Digitalisierung ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen für die
Entwicklung unseres Freistaates. Dies wird sich auch im
Wissenschaftsbereich noch verstärkt widerspiegeln müssen. Die Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften haben insbesondere durch ihre Zusammenarbeit
mit der regionalen Wirtschaft dafür ein großes Potential. Dieses wollen
wir aufgreifen und mit der Einrichtung der Digitalisierungsprofessoren in
Leipzig einen weiteren Akzent setzen. Damit soll das Thema Digitalisierung
einen neuen Impuls erhalten, wohl wissend, dass die Entwicklung - auch
begleitetet durch die Wissenschaftspolitik – weitergehen muss.“
Holger Mann, hochschulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, erklärt: „Die
Koalition untersetzt das Zukunftsfeld ‚Digitalisierung‘ inhaltlich bei
Lehre und Forschung. Mit zwei zusätzlichen Professuren für Angewandte
Digitalisierung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in
Leipzig setzen wir einen neuen Impuls an den Schnittstellen verschiedener
Fächer. Die HTWK Leipzig wird so in die Lage versetzt, ein
Querschnittsprofil zur Angewandten Digitalisierung aufzubauen. Zudem wird
ihre Grundfinanzierung gestärkt. Neben den beiden Professuren sollen
hierfür jährlich weitere 300.000 Euro zur Verfügung stehen. In Kombination
mit den drei Millionen Euro für interdisziplinäre und angewandte Forschung
im Bereich der Digitalisierung aus Mitteln der Landesforschungsförderung
ist der neue Akzent im Wissenschaftshaushalt deutlich erkennbar.“
- Aufrufe: 88