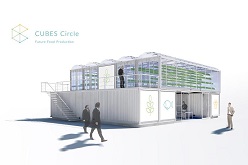Kresse hat sich genetisch an schwermetall-verseuchte Böden angepasst

Blei, Zink, Cadmium: Was Mensch, Tier und die meisten Pflanzen schwer
krank macht, stört die Hallersche Schaumkresse wenig. Sie hat sich
genetisch so angepasst, dass sie auch auf Böden wachsen kann, die mit
Schwermetallen verseucht sind. Dies wiesen Forschende der Eidgenössischen
Forschungsanstalt WSL an Pflanzen von unterschiedlich stark belasteten
Standorten nach.
Die polnische Olkusz-Region, die eines der grössten Blei-Zink-Vorkommen
der Welt und entsprechend viele Minen beherbergt, hält einen traurigen
Rekord: Hier liegen einige der am stärksten verseuchten Böden Europas. Die
mittleren Konzentrationen von Cadmium, Zink und Blei können fünf- bis
zehnmal so hoch sein wie die Sanierungsgrenzwerte in der Schweiz. Pflanzen
wachsen schlecht hier, denn die Schwermetalle verlangsamen die biologische
Aktivität im Boden und behindern wichtige Prozesse in den Pflanzenzellen.
Die Hallersche Schaumkresse (Arabidopsis halleri) jedoch gedeiht in dieser
Region prächtig. Sie hat im Laufe der Evolution einen besonders effektiven
Umgang mit Umweltgiften erworben. Dies wiesen Forschende der Eidg.
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL gemeinsam mit
Forscherinnen von der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) in
Krakau in einer genetischen Studie nach. Sie stützen sich dabei auf einen
polnischen Feldversuch, bei dem Kressepflanzen von vier Standorten – zwei
verseuchten und zwei unverseuchten – untersucht wurden.
Reaktion auf Umweltstress
Die WSL-Forscher Christian Sailer und Christian Rellstab haben das gesamte
Genom der verschiedenen Gewächse untersucht. «Wir haben bei Pflanzen von
Standorten mit und ohne Schwermetalle markante Unterschiede an bestimmten
Stellen im Genom gefunden», sagt Rellstab. «Dies dürfte damit
zusammenhängen, dass sich diese Kresse an Schwermetalle im Boden angepasst
hat, und zwar durch genetische Veränderungen an genau diesen Stellen.» Die
betreffenden Gene steuern Reaktionen, mit denen Pflanzen auf widrige
Umweltbedingungen reagieren. In einem Fall handelt es sich um den
Transport von Metallen in bestimmte Zellbestandteile, die Vakuolen, in
denen Schwermetalle und andere Gifte eingelagert und so unschädlich
gemacht werden. Andere der entdeckten Erbgutabschnitte gehören zum
Reparatursystem, das durch Schwermetalle verursachte Schäden an
Zellbestandteilen oder an der DNA korrigiert.
Böden mit Pflanzen reinigen
Diese Resultate, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports
veröffentlicht wurden, sind für die Sanierung von verseuchten Standorten
von Bedeutung – möglicherweise auch in der Schweiz. Laut dem Altlasten-
Kataster sind über 30‘000 Standorte auf einer Fläche von insgesamt 220
Quadratkilometern mit Chemikalien und Schwermetallen belastet, was der
Grösse des Kantons Zug entspricht. Rund 4000 Standorte werden saniert. Die
Begrünung mit Pflanzen ist ein möglicher Weg dafür, indem entweder der
Bewuchs den belasteten Boden stabilisiert, oder indem die Pflanzen die
Schadstoffe aufnehmen, welche dann durch Ernten entfernt werden können.
Die Hallersche Schaumkresse ist zwar zu klein dafür, aber ein sehr gutes
Forschungsobjekt. Sie kann nämlich nicht nur extrem hohe
Schwermetallkonzentrationen aushalten, sondern auch grosse Mengen davon
aus dem Boden aufnehmen und in ihren Pflanzenzellen unschädlich einlagern.
Die aktuelle Studie zeigt, dass dabei vor allem die Transport-Gene eine
wichtige Rolle spielen. Diese Mechanismen besser zu verstehen, könnte
dabei helfen, besonders widerstandsfähige Pflanzen für die Bodensanierung
zu züchten.
«Damit wir angepasste Pflanzen für die Sanierung verwenden können, müssen
wir die Mechanismen der Schwermetall-Anpassung genau kennen», sagt der
Pflanzenphysiologe Pierre Vollenweider von der WSL. Die Studie baut auf
Erfahrungen der WSL-Forschenden mit dem Genom von A. halleri auf, sowie
auf frühere Forschungsprojekte zur Anpassung von Pflanzen an Schwermetalle
und andere Umweltbelastungen. Die Zusammenarbeit mit den polnischen
Kolleginnen entstand durch das erste Sciex-Programm, ein Förderprogramm
des Bundes im Rahmen der EU-Osterweiterung.
Originalpublikation:
Christian Sailer et al. Transmembrane transport and stress response genes
play an important role in adaptation of Arabidopsis halleri to
metalliferous soils. Scientific Reports, volume 8, Article number: 16085
(2018). DOI: 10.1038/s41598-018-33938-2
- Aufrufe: 79