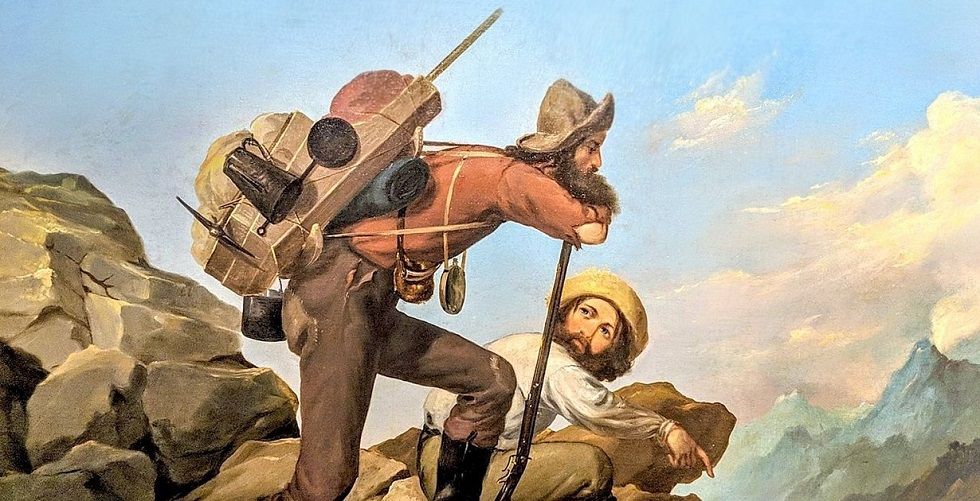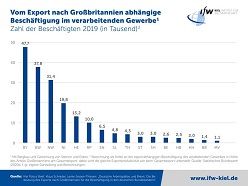Grüner Aufschwung: Ist die EU auf dem richtigen Weg?
„Green Recovery Tracker“ des Wuppertal Instituts und E3G bewertet
Klimaschutz-Beitrag der nationalen Konjunkturmaßnahmen
Die Aufbau- und Resilienzfazilität – auch Recovery and Resilience Facility
– der EU stellt rund 672,5 Mrd. Euro für die von den Mitgliedstaaten
nationalen Konjunkturpläne bereit. Im Juli 2020 haben sich die
europäischen Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, dass sie mit
einer grünen Transformation in Einklang gebracht werden müssen. Werden die
vorgeschlagenen Maßnahmen der Mitgliedstaaten diesen Ambitionen auch
gerecht? Der „Green Recovery Tracker“ des Wuppertal Instituts und E3G
nimmt das genauer unter die Lupe. Erste Ergebnisse stellen sie heute vor.
Berlin/Wuppertal, 17. März 2021: Der „Green Recovery Tracker“ bewertete
bisher neun nationale Konjunkturpläne der EU aus Frankreich, Deutschland,
Spanien, Portugal, Bulgarien, Lettland, Polen, der Slowakei und Slowenien.
Weitere Analysen folgen in den kommenden Wochen, sobald weitere
Konjunkturpläne der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die EU auf einem guten
Weg zu einem grünen Aufschwung befindet. Bisher wurden rund 133 Milliarden
Euro zur Unterstützung der grünen Transformation bereitgestellt.
„Wir freuen uns, dass die EU-Mitgliedstaaten die Gelegenheit ergreifen,
dringend benötigte Investitionen in eine grüne wirtschaftliche Erholung zu
tätigen“, sagt Johanna Lehne, Senior Policy Advisor bei E3G. „Die Pläne,
die wir bisher gesehen haben, sind mehr als nur fiskalische Anreize mit
Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und
Übergangsinfrastruktur.“ Polen beispielsweise nutzt die Konjunkturmittel,
um seine Offshore-Windenergie-Industrie auszubauen. Spanien plant
umfangreiche Investitionen in eine inklusivere Energiewende und will seine
Ziele für erneuerbare Energien beschleunigen. Bulgarien unterstützt die
Energieeffizienz- und erneuerbare Heizungsmaßnahmen für freistehende
Häuser, die nicht an Wärme- und Gasnetze angeschlossen sind.
Noch ist nicht sicher, dass die Wirtschaft auf den richtigen Weg für
langfristige Herausforderungen ist. Denn bei vielen Plänen liegen die
Details noch nicht vor, wie beispielsweise Maßnahmen umgesetzt und welche
konkreten Projekte gefördert werden sollen. Die Daten des „Green Recovery
Tracker“ belegen, dass rund 76 Milliarden Euro oder 21 Prozent der
geplanten Gesamtausgaben in Maßnahmen fließen, deren Klimaeffekt noch
nicht abschätzbar ist. Diese könnten nach der Umsetzung sowohl positiv als
auch negativ sein.
Es stehen in den kommenden Wochen und Jahren wichtige Entscheidungen an,
in denen die Pläne der Mitgliedstaaten fertiggestellt und von den
europäischen Institutionen überprüft werden, sobald sie umgesetzt werden.
„Es bleibt abzuwarten, ob die EU den wirtschaftlichen Aufschwung mit dem
langfristigen Ziel der Klimaneutralität in Einklang bringen kann“, sagt
Timon Wehnert, Leiter Büro Berlin und Senior Researcher am Wuppertal
Institut, und ergänzt: „Das Risiko ist hoch, dass Maßnahmen, die auf den
ersten Blick „grün“ aussehen, letztlich fossile Energieträger unterstützen
oder auch einige Pläne schädliche Maßnahmen enthalten.“
Beispiele hierfür seien etwa Investitionen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro
in dringend benötigte Effizienzmaßnahmen in Polen, mit denen auch
Erdgaskessel gefördert werden könnten, Investitionen von rund 244 Millonen
Euro in die bulgarische Gasinfrastruktur, wobei derzeit unklar ist, ob
diese Infrastruktur auch für Wasserstoff genutzt werden kann, sowie rund
723 Millionen Euro für das Straßennetz in Portugal.
Die meisten bisher vorliegenden Entwürfe für Konjunkturprogramme wurden
nicht von effektiven Steuerungsmechanismen oder Reformen begleitet. Oft
werden die Gelder zur Finanzierung bereits vereinbarter Programme
verwendet, anstatt neue transformative Maßnahmen aufzusetzen. Darüber
hinaus fehle es oft an Leistungsindikatoren und Schritten, um die
Anpassung der Sanierungsmaßnahmen an den breiteren politischen Rahmen der
Energiewende sicherzustellen.
Politischer Kontext der nationalen Konjunktur- und Resilienz-Pläne
Alle EU-Mitgliedstaaten müssen bis Ende April 2021 nationale
Konjunkturpläne vorlegen, um die Mittel der 672,5 Milliarden Euro schweren
Recovery and Resilience Facility (RRF) abrufen zu können. Die RRF-
Verordnung sieht vor, dass mindestens 37 Prozent der Gelder, die in den
nationalen Plänen ausgegeben werden, die Klimaziele unterstützen, während
der Rest der Gelder dem grünen Übergang „keinen signifikanten Schaden“
zufügen sollen. Um diese Kriterien zu erfüllen, überprüft die Europäische
Kommission die Pläne formal sobald sie vorliegen. Das Europäische
Parlament kontrolliert diese anschließend.
Launch des „Green Recovery Tracker“
Der Green Recovery Tracker wird heute, 17. März 2021 um 14 Uhr offiziell
während des Launch-Events „Is Europe on Track for a Green Recovery“
vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Wuppertal Instituts und E3G
die neusten Ergebnisse zum Stand der Recovery-Pläne der EU-
Mitgliedstaaten.
- Aufrufe: 74