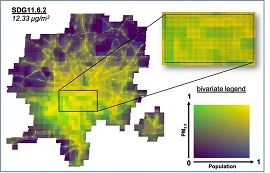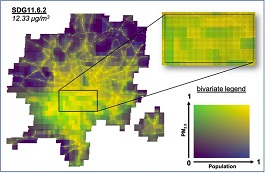Stromspeicher-Inspektion 2023: Lithium-Batterien sind im Vergleich zu ihren Alternativen noch klar im Vorteil

In der neuesten Ausgabe ihres Stromspeichertests nahm die Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) nicht nur Lithium-Ionen-
Batteriesysteme unter die Lupe. Erstmals analysierte sie zusammen mit dem
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) auch sogenannte Salzwasser- und
Hochtemperaturbatterien. Das Fazit: In puncto Energieeffizienz sind
Lithium-Ionen-Batterien den alternativen Batterietechnologien derzeit noch
deutlich überlegen.
Der für den Klimaschutz erforderliche Photovoltaik-Ausbau wird nur
erfolgreich sein, wenn auch deutlich mehr effiziente Stromspeichersysteme
installiert werden. Neben den etablierten Lithium-Ionen-Batterien stehen
weitere Batterietechnologien in den Startlöchern. Wie effizient die
Alternativen sind, untersuchten Forschende der HTW Berlin und des KIT in
der Studie Stromspeicher-Inspektion 2023. Das Ergebnis: In Natrium-Ionen-
und Natrium-Nickelchlorid-Batterie
Batterien noch deutlich höhere Verluste auf. Die Labortests belegen, dass
die Speicherverluste der Natrium-Nickelchlorid-Batterie
Siebenfache höher sind als die der Lithium-Ionen-Batterien. Ebenfalls
verbesserungswürdig ist die geringe Leistungsfähigkeit der Natrium-Ionen-
Batterien, die zudem mit sinkendem Ladezustand linear abnimmt. Weitere
technische Unterschiede und Optimierungspotenziale der verschiedenen
Batterietechnologien zeigen die Forschenden in der neuen Studie auf.
Die aktuelle Dominanz der Lithium-Ionen-Batterietechnolo
auch in ihrem beachtlichen Marktanteil in Deutschland wider: 98 Prozent
der rund 200 000 Heimspeichersysteme, die im vergangenen Jahr installiert
wurden, waren Lithium-Systeme. Die Anzahl der Neuinstallationen stieg 2022
im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 44 Prozent. Besonders im Trend sind
dabei Lithium-Eisenphosphat-Batterie
des Speichermarkts zeigt. Innerhalb von fünf Jahren verdoppelten Lithium-
Eisenphosphat-Batterien ihren Anteil auf knapp 70 Prozent im Jahr 2022.
Des Weiteren beobachten die Forschenden der HTW Berlin eine rasante
Marktentwicklung der Hybridwechselrichter. Drei von vier Photovoltaik-
Speichersystemen wurden im Jahr 2022 mit einer DC-Anbindung des
Batteriespeichers realisiert. Vor vier Jahren führten noch AC-gekoppelte
Batteriesysteme den deutschen Heimspeichermarkt an.
In einem weiteren Schwerpunkt der Stromspeicher-Inspektion 2023 bewertete
die HTW Berlin die Energieeffizienz von Solarstromspeichern - seit 2018
zum sechsten Mal in Folge. Die Forschungsgruppe „Solarspeichersysteme“
prüfte 18 Speichersysteme von 11 Unternehmen, darunter namhafte Hersteller
wie BYD, Fronius, Kostal, Varta und Viessmann. Mit einem exzellenten
Wechselrichterwirkungsgrad im Entladebetrieb von 97,8 Prozent punktete RCT
Power im Effizienztest. Der Hybridwechselrichter von Kaco beeindruckte
hingegen mit einer Einschwingzeit von unter 200 Millisekunden. Mit diesen
Werten stellten die beiden Hersteller nicht nur neue Rekorde auf, sondern
verbesserten obendrein den System Performance Index (SPI) ihrer Produkte.
Die an der HTW Berlin entwickelte Bewertungsgröße dient als Grundlage für
den Effizienzvergleich der Geräte.
„Wie bereits in den vergangenen Jahren stehen erneut nur
Hybridwechselrichter in Kombination mit Hochvolt-Batterien auf dem
Siegertreppchen“, resümiert Johannes Weniger, Initiator der Stromspeicher-
Inspektion. Insgesamt konnten die Forschenden in diesem Jahr sieben
Systemen die höchste Effizienzklasse A attestieren. Der Vergleich zweier
Speichersysteme sehr unterschiedlicher Effizienz in der Studie
unterstreicht: Wer auf ein hocheffizientes Photovoltaik-Speichersystem
setzt, kann innerhalb der ersten zehn Betriebsjahre bis zu 1700 €
zusätzlich einsparen.
Um Privatpersonen bei der Suche nach einem effizienten Heimspeicher zu
unterstützen, entwickelte die Forschungsgruppe den Stromspeicher-
Inspektor, der auf den Ergebnissen der Studie aufbaut. „Mit unserem neuen
Online-Tool können Interessierte die wichtigsten Effizienzeigenschaften
der Speichersysteme noch einfacher vergleichen“, sagt Michaela Zoll,
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe
Solarspeichersysteme. Der Clou: Alle aufgelisteten Kennwerte wurden von
unabhängigen Prüfinstituten ermittelt und auf Plausibilität geprüft. Der
Stromspeicher-Inspektor wird ab sofort kontinuierlich um Produktneuheiten
erweitert und macht diese somit schneller vergleichbar. Interessierte
Hersteller können sich hierzu direkt an die Forschungsgruppe
„Solarspeichersysteme“ der HTW Berlin wenden.
Die Stromspeicher-Inspektion 2023 entstand im Projekt „Perform“, das vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird.
- Aufrufe: 2