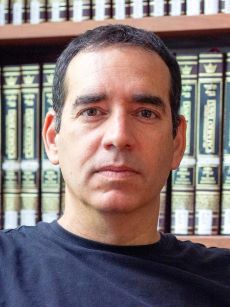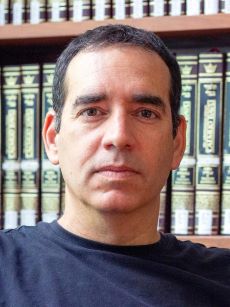Prof. Dr. Christian Zang erhält Ars legendi-Preis 2024 für exzellente Lehre

Prof. Dr. Christian Zang von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT)
erhielt den Ars legendi-Fakultätenpreis 2024 für exzellente Lehre in den
Wald- und Forstwissenschaften. Der Preis wurde erstmals vom
Stifterverband, dem Forstlichen Fakultätentag und den forstlichen
Hochschulen in Zusammenarbeit mit der Sattelmühle-Stiftung verliehen.
Die feierliche Verleihung des Ars legendi-Fakultätenpreises Wald- und
Forstwissenschaften fand am 15. Oktober 2024 bei der Stiftung Sattelmühle
auf dem Forstgut Sattelmühle statt. Die Jury, bestehend aus
Fachvertreterinnen und -vertretern, hat Prof. Dr. Christian Zang
https://www.hswt.de/person/chr
Leistungen in der Lehre ausgewählt. Seit 2021 Inhaber der Professur
„Forests and Climate Change“ https://www.hightechagenda.de/
dr-christian-zang/, überzeugte er durch innovative Lehrmethoden und ein
besonderes Engagement für seine Studierenden. Sein Lehransatz ermöglicht
es ihm, aktuelle Forschungserfahrungen direkt an die Studierenden
weiterzugeben und darüber hinaus einen bedeutenden Beitrag zur
Weiterentwicklung der Lehre zu leisten.
Auszeichnung für innovative Lehre und herausragendes Engagement
Besonders hervorzuheben sind Prof. Dr. Zangs Fähigkeiten im Bereich der
Digitalisierung, die innovative Formen der interdisziplinären Lehre
fördern. Durch den Einsatz technischer Innovationen unterstützt er die
Studierenden nachhaltig in der Auswertung komplexer Daten, was die
Qualität der Ausbildung auf ein neues Niveau hebt und auch positive
Auswirkungen auf andere Fachrichtungen und das gesamte Curriculum hat.
Hochschulpräsident Dr. Eric Veulliet https://www.hswt.de/person/eri
veulliet zeigt sich beeindruckt: „Die erstmalige Vergabe des Ars legendi-
Fakultätenpreises für exzellente Lehre in den Wald- und
Forstwissenschaften ist ein Triumph für die HSWT. Prof. Dr. Christian Zang
wird als herausragender Leistungsträger gewürdigt, der sich in der
Fakultät Wald und Forstwirtschaft auf vielfältige Weise vorbildlich und
innovativ für die Interessen von Studierenden und dem wissenschaftlichen
Nachwuchs engagiert.“
Auch Prof. Dr. Jörg Ewald https://www.hswt.de/person/joe
der Fakultät Wald und Forstwirtschaft
https://www.hswt.de/hochschule
forstwirtschaft, freut sich: „Der erstmals von allen deutschen Hochschulen
und Universitäten gemeinsam ausgelobte Preis für exzellente
forstwissenschaftliche Lehre schließt eine wichtige Lücke. Mit Prof. Dr.
Christian Zang wird ein Leistungsträger geehrt, der sich in der Fakultät
Wald und Forstwirtschaft auf allen Ebenen vorbildlich und innovativ für
die Belange von Studierenden und wissenschaftlichem Nachwuchs einsetzt.
Als „digital native“ motiviert er den forstlichen Nachwuchs für eine
produktive Anwendung von digitalen Werkzeugen und großen Datenmengen, die
für die Anpassung unserer Wälder unverzichtbar sind.“
Exzellente Lehre über die Forstwirtschaften hinaus
Prof. Dr. Zang integriert fortlaufend seine Forschungsergebnisse in die
Lehre, was einen schnellen und direkten Wissenstransfer ermöglicht. Dies
zeigt sich in ausgezeichneten Lehrbewertungen und seiner großen
Beliebtheit als Betreuer von Abschlussarbeiten. Er schätzt seine Arbeit:
„Der Klimawandel stellt die größte Herausforderung für Wälder und die
Forstwirtschaft weltweit dar. Die Möglichkeit, durch meine Lehre zum
Verständnis der oft komplexen Zusammenhänge beizutragen und durch
integrative Ansätze Handlungsperspektiven aufzuzeigen, ist für mich eine
besondere Motivation in meiner täglichen Arbeit als Hochschullehrer.“
Prof. Dr. Zang bietet eine Bandbreite an Lehrveranstaltungen in
verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen, sowohl in deutscher als
auch in englischer Sprache an. In seiner Funktion als Studiendekan für den
Studiengang Forstingenieurwesen sowie zwischenzeitlich für den neu
etablierten Studiengang Arboristik und urbanes Waldmanagement engagiert er
sich auch über seine eigenen Veranstaltungen hinaus.
In diesem Interview https://www.hswt.de/news-list/
fakultaetenpreis-fuer-prof-dr-
Zang, welche Bedeutung dieser Preis für ihn hat.
Verfasserin: Lea Dinter, Pressestelle der HSWT
- Aufrufe: 87