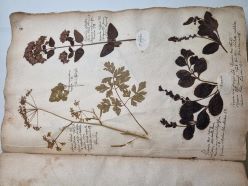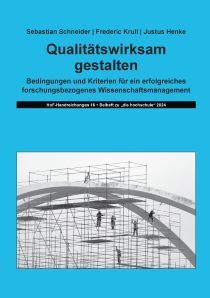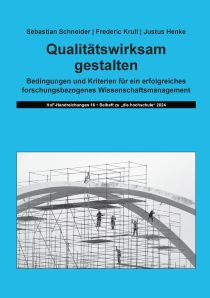CAPTN Initiative beendet Forschungsprojekt Förde 5G erfolgreich

Förde 5G zielte darauf ab, den Bedarf und Nutzen des
Mobilfunkstandards 5G in den Bereichen Mobilität, Logistik und Segeln an
der Kieler Innenförde zu erforschen und zu erproben.
• Vier Teilprojekte beschäftigen sich mit Anwendungen für die
Bereiche 5G-Simulation, -Datenmanagement und -Kontrollzentrum sowie
Hafenlogistik und Segeln
• Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr
(BMDV) mit rund 3,6 Millionen Euro
Das Projekt Förde 5G der CAPTN Initiative befindet sich auf der
Zielgeraden. In den vergangenen drei Jahren forschten Wissenschaftler und
Industriepartner an Anwendungsmöglichkeiten des 5G-Mobilfunks im Bereich
des maritimen Verkehrs. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Fernsteuerung
eines Schiffes als Vorbereitung für den Betrieb einer (teil-)autonomen
Personenfähre. Heute stellten die Forschenden ihre Ergebnisse in Kiel vor.
Von Oktober 2021 bis jetzt befasste sich das Projekt CAPTN Förde 5G mit
den Möglichkeiten, die der Mobilfunkstandard 5G der maritimen Wirtschaft
bietet. Forschungsschwerpunkt ist dabei die Kieler Förde. Hier befassten
sich vier Teilprojekte mit Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen
Schifffahrt, Hafenlogistik und Segelsport. Herzstück des vom
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit rund 3,6 Millionen
Euro geförderten Vorhabens lag in der Erforschung der Voraussetzungen für
den Betrieb einer (teil-) autonomen Personenfähre in Bezug auf die
Übertragung von Daten, Datensicherheit, Überwachung und Kontrolle.
Kernstück des Projekts stellte ein Kontrollzentrum dar, von dem aus ein
Schiff – der CAPTN-Forschungskatamaran MS Wavelab – mit Hilfe von
Mobilfunk ferngesteuert und überwacht werden sollte. Dazu müssen alle
Daten von Kamerabildern über Radar bis zu den Antrieben verzögerungsfrei
von der Brücke ins landseitige Remote Operation Center (ROC) gesendet
werden. „Das Kernziel von Förde 5G lag darin, eine autonome Fähre mittels
5G ferngesteuert oder teilautonom über die Förde zu fahren. Dieses Ziel
haben wir erreicht: Die Fernsteuerung des Forschungskatamarans MS Wavelab
mittels Mobilfunks funktioniert. Die Forschung dazu ist nicht trivial,
denn wir müssen alle Objekte auf dem Wasser zuverlässig im Kontrollzentrum
erkennen - vom Schwimmer über den Kajakfahrer bis hin zum
Kreuzfahrtschiff. Hinzu kommen Manöver, die vom Kontrollzentrum ohne
Zeitverlust gesteuert werden können“, erklärt Professor Dr. Olaf
Landsiedel AG Verteilte Systeme, an der Christian-Albrechts-Universitä
Kiel (CAU).
Projektkoordinator ist die Stadt Kiel. Auch für Kiels Oberbürgermeister
Dr. Ulf Kämpfer ist CAPTN Förde 5G ein Schritt in Richtung innovativen und
zeitgemäßen öffentlichen Nahverkehr: „Die Digitalisierung unserer
Verkehrsträger und Infrastruktur ist ein zentraler Baustein für einen
attraktiven ÖPNV in Kiel. Das Förde 5G-Projekt der CAPTN Initiative hat
einen enormen Wissenszuwachs rund um die Nutzung von öffentlich
verfügbarem 5G für unsere Region gebracht. Es ist ein tolles Beispiel
dafür, wie durch die enge Zusammenarbeit von regionalen Unternehmen, der
Stadt und den Hochschulen positive Effekte für die Stadtentwicklung
entstehen.“
Forschungsbereiche: Schifffahrt, Hafenlogistik, Segelsport
In den vergangenen drei Jahren haben sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der CAU und die Industriepartner des Kieler Anbieter für
digitale Dienstleistungen Addix GmbH und der Anschütz GmbH, Hersteller von
Navigations-, Überwachungs- und Kontrollsysteme, damit befasst, große
Datenmengen von Sensoren und Kameras in kürzester Zeit zuverlässig ins
Kontrollzentrum zu übertragen, damit dort störungsfrei
Steuerentscheidungen getroffen und ans Schiff zurückgesendet werden
können. „5G als drahtlose Kommunikationstechnologie hat bewiesen, dass
sich die benötigten hohen Datenraten mit niedrigen Latenzen übertragen
lassen“, fasst Björn Schwarze, Geschäftsführer von Addix, das Ergebnis des
Projektziels zusammen. „Damit haben wir erfolgreich gezeigt, dass Schiffe
über das öffentliche 5G-Netz aus einem Kontrollzentrum gesteuert werden
können und eine sichere Schiff-Land-Verbindung möglich ist“, ergänzt er.
Im Bereich der Hafenlogistik haben die Projektpartner Port of Kiel und die
CAU den Materialfluss während des Ein-, Um- und Auslagerungsprozesses
digital überwacht und lokalisiert. Die Lokationen der einzelnen Güter
sollte jederzeit digital abgefragt und so den Transporten zugeordnet
werden können. Dadurch werden Ein-, Um- und Auslagerungsprozesse
beschleunigt und kostengünstiger, fehlerhafte Verladungen können
verhindert werden. Auch für den Segelsport entstanden durch Förde 5G
wichtige Erkenntnisse. So ist dank 5G die Echtzeitübertragung von Daten
zum Coaching und in Regatten möglich und im Rahmen von Förde 5G erprobt
worden.
Bei der heutigen Abschlussveranstaltung stellten alle Projektpartner ihre
Ergebnisse vor. Dabei bekamen die Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft die Möglichkeit, die Ergebnisse anhand von Postern und
Demonstratoren zu erleben und zu diskutieren. Auch die abschließende
Fishbowl-Diskussion zur Fragestellung „Welche Potenziale entstehen durch
die Nutzung der 5G-Technologie für die maritime Wirtschaft?“ animierte
viele Interessierte zur aktiven Teilnahme. Damit endet CAPTN Förde 5G. Ein
Anschlussprojekt ist nicht geplant.
Partner
Landeshauptstadt Kiel
Christian-Albrechts-Universitä
AVL Deutschland GmbH
Anschütz GmbH
ADDIX GmbH
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG
HH Vision GmbH & Co. KG
Bildunterschrift: Steuerungsgruppe Förde 5G: (V. li) Lisa-Marie Freundel
(DSN Connecting Knowledge); Lars Gummels (Port of Kiel), Jonas Dageförde
(Stadt Kiel),Prof. Dr. Reinhard von Hanxleden (CAU zu Kiel), Prof. Dr.
Olaf Landsiedel (CAU zu Kiel), Prof. Dr. Martina Gerken (CAU zu Kiel),
Ralf Duckert (DSN Connecting Knowledge), Daniel Laufs
(Wissenschaftszentrum Kiel), Björn Schwarze (Addix), Dr.-Ing. Christian
Schyr (AVL).
- Aufrufe: 21