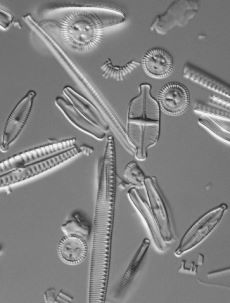Julia Wolf, Absolventin des MBA-Studiengangs „Management in der Weinwirtschaft“ mit Gerd Erbslöh-Preis ausgezeichnet

Gerd Erbslöh-Preis für Master-Thesis zur „Untersuchung der sensorischen
Differenzierbarkeit der VDP-Klassifikation im mittleren Rheingau“
verliehen
Julia Wolf, Absolventin des MBA-Studiengangs „Management in der
Weinwirtschaft“ wird für ihre herausragende Arbeit, in der sie sich
kritisch mit dem Bezeichnungsrecht auseinandersetzt von der Gerd Erbslöh-
Stiftung mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro belohnt.
Die Master-Thesis der Preisträgerin mit dem Titel „Untersuchung der
sensorischen Differenzierbarkeit der VDP-Klassifikation im mittleren
Rheingau“ hinterfragt, ob Deutschland im Vergleich zu anderen
weinbautreibenden Ländern durch die Vielzahl an Regularien zu kompliziert
oder unverbesserlich ist und ob sich die Herkunft und die Einstufung der
VDP-Qualitätspyramide sensorisch differenzieren lässt. Des Weiteren wird
erörtert, ob die Winzerinnen und Winzer, welche der Klassifikation folgen,
überzeugt davon sind, dass die Einstufung in vier Klassifikationsmerkmale
sinnvoll ist oder ob sie es gerne anders machen würden. Betreut wurde die
Arbeit von Prof. Dr. Rainer Jung, stellvertretender Institutsleiter des
Instituts für Oenologie der Hochschule Geisenheim.
Am 25. Oktober 2024 nahm Julia Wolf die Urkunde und den Pokal feierlich
aus den Händen von Dieter Erbslöh und Professor Jung entgegen. Im
Anschluss stellte sie ihre Forschungsarbeit vor, ergänzt durch eine
sensorische Verkostung. Die Anwesenden hatten die Möglichkeit, die
theoretischen Ergebnisse direkt geschmacklich zu erleben. Wolf
präsentierte eine Auswahl an Weinen der Weingüter Prinz, Ress, Barth und
Kaufmann, um die sensorischen Unterschiede und Herausforderungen der VDP-
Klassifikationen zu verdeutlichen.
Die Veranstaltung mündete in eine lebhafte Podiumsdiskussion zum Thema
„Öchsle oder Terroir – Zukunft des Bezeichnungsrechts“. Neben der
Preisträgerin nahmen Experten wie Prof. Dr. Rainer Jung, Michael Engisch
von der Prüfstelle Rheinland-Pfalz, Rheingauer Weinbaupräsident Peter
Seyffardt, Johannes Eser, Weingut Johannishof und Mark Barth vom Weingut
Barth teil. Gemeinsam diskutierten sie unter Moderation von Prof. Dr.
Otmar Löhnertz die künftige Ausrichtung des Bezeichnungsrechts und die
Bedeutung einer sensorischen Nachvollziehbarkeit der Herkunft.
Die Auszeichnung von Wolfs Arbeit und die darauffolgende Diskussion an der
Hochschule Geisenheim setzen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung
des deutschen Weinklassifikationssystems und regt zum Austausch über die
Zukunft des Bezeichnungsrechts an.
Preisgeber ist die 2008 vom Geisenheimer Unternehmer Gerd Erbslöh ins
Leben gerufene gleichnamige Gerd Erbslöh-Stiftung. Sie widmet sich der
Förderung von Bachelor-, Master- und Promotionsarbeiten, die die
Entwicklung der Hochschule Geisenheim fördern oder besondere Leistungen im
Bereich der Getränketechnologie oder der Oenologie darstellen.
- Aufrufe: 124