Dicke Luft in den Städten lokalisieren

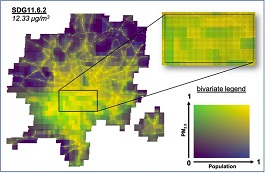
Dank einer aktuellen Studie mit maßgeblicher Beteiligung des Helmholtz-
Zentrums Hereon lässt sich die Verteilung von Feinstaub in Städten genauer
berechnen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN),
kann so der Indikator 11.6.2 zur Erfassung der Belastung mit Feinstaub in
Städten detaillierter berechnet werden. Vorteile der neuen Methode sind
die genauere Bestimmung des Indikators und die Möglichkeit der
einheitlichen Anwendung auf ganz Europa. Am Beispiel Hamburgs zeigt sich
so eine unterschiedliche Belastung nach Bezirken, Stadtteilen und sogar
Häuserblocks. Die Studie erschien jüngst in der Fachzeitschrift Remote
Sensing.
Menschen in Großstädten atmen mitunter dicke Luft. Feinstaub und andere
Schadstoffe sorgen für Gesundheitsrisiken. Die Forschenden um Dr. Martin
Ramacher vom Hereon-Institut für Umweltchemie des Küstenraumes machen in
Zusammenarbeit mit dem National Observatory of Athens die Bestimmung von
Feinstaub mit einer Größe kleiner 2,5 Mikrometer (PM2.5) nun exakter. Dazu
nutzten sie offen verfügbare EU-weite Copernicus-Satellitendaten in
Kombination mit dem Chemietransportmodell EPISODE-CityChem. Das am Hereon
entwickelte System konnte am Beispiel Hamburgs mit einer Auflösung von 100
x 100 Quadratmetern Hotspots für schlechte Luft modellieren. Die
berechneten Feinstaub-Konzentrationen werden mit Bevölkerungsdaten
kombiniert und können so zeitgleich auf Gebiete mit schlechter
Luftqualität und hoher Bevölkerungsdichte hinweisen. Diese Gebiete sind
von besonderem Interesse, um Verbesserungen der Luftqualität zu erreichen.
Wegweisend an der entwickelten Methode ist die Kombination
unterschiedlicher und für ganz Europa frei verfügbarer Satellitendaten mit
stadtskaligen Modellrechnungen.
Im Vergleich mit dem bisher von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für
das verwendete Beispieljahr 2016 erhobenen Mittelwert von 14 Mikrogramm
pro Kubikmeter für die ganze Stadt unterlagen die Hamburger tatsächlich
geringeren Feinstaubkonzentrationen von 11 bis 12 Mikrogramm pro
Kubikmeter im städtischen Durchschnitt. Die neuen detaillierten
Berechnungen zeigen allerdings, dass die Belastung im Stadtgebiet
unterschiedlich verteilt ist und in einigen Stadtteilen auf bis zu 17
Mikrogramm pro Kubikmeter steigen kann. „Insbesondere an stark befahrenen
Straßen und im hafennahen Industriegebiet im Süden der Elbe haben wir für
das Beispieljahr 2016 erhöhte Jahresmittelwerte für die
Feinstaubkonzentrationen ermitteln können. Während in Nähe der
Industriegebiete relativ wenige Menschen leben, konnten wir nachweisen,
dass gerade in der Nähe stark befahrener Straßen auch viele Menschen leben
und damit von erhöhten Konzentrationen betroffen sind. Diese
Untersuchungen von Luftverschmutzungs-Hotspots sind bisher im UN-Indikator
untergegangen. Mit unserem Ansatz aber lässt sich im Einklang mit dem
Indikator die Belastung besser erfassen und kann lokalen
EntscheidungsträgerInnen helfen, Gegenmaßnahmen auf den Weg zu bringen“,
sagt Ramacher. Insgesamt liegt Hamburg im Vergleich zu anderen
europäischen Großstädten unter dem europäischen Durchschnitt der
Feinstaubbelastung und überschreitet nicht den jährlichen EU-Grenzwert von
20 Mikrogramm pro Kubikmeter für Feinstaub mit einer Größe kleiner 2,5
Mikrometer (PM2.5).
Hintergrund
Der SDG-Indikator 11.6.2 wurde von den Vereinten Nationen entwickelt, um
die Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch Luftverschmutzung in
Städten global zu thematisieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat
Ende September 2021 aktualisierte Leitlinien für Luftqualitätsrichtwerte
veröffentlicht, um auf die Bedrohung durch Verschmutzung zu reagieren. Zu
den Auswirkungen jener gehören jährlich sieben Millionen vorzeitige
Todesfälle weltweit und viele Millionen Menschen, die krank werden. Auch
in Europa ist die Luftverschmutzung noch immer ein großes
Gesundheitsproblem.
Die lokale Definition des SDG-Indikators 11.6.2 bringt Herausforderungen
mit sich – vor allem wegen der Vielfalt der Ursachen für Luftverschmutzung
etwa durch unterschiedlichste Emissionsquellen und andere
Einflussfaktoren. Die oft zu wenigen Messstellen können die räumliche
Komplexität nicht genau erfassen. Die vom Hereon und dem National
Observatory of Athens gemeinsam durchgeführte Studie soll die Diskussion
über die Möglichkeiten des SDG-Indikators 11.6.2 für lokale Entscheidungen
vorantreiben. Denn es braucht detaillierte innerstädtische Informationen
über Verschmutzung und die Bevölkerung, um die bisherige Forschungslücke
zu schließen und damit der dicken Luft Herr zu werden.






