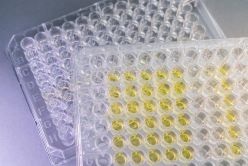Reporterhaut: In-vitro-Haut macht Zellreaktion auf Testsubstanz in Echtzeit messbar
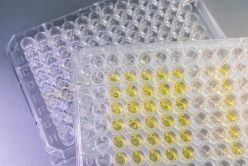
Die EU hat Tierversuche zur Testung von Kosmetika verboten und bei der
Risikobewertung neuer chemischer Stoffe sind tierversuchsfreie
Alternativmethoden vorzuziehen. Am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen-
und Bioverfahrenstechnik IGB wurde nun erstmals ein dreidimensionales
Hautmodell aufgebaut, das die Reaktion der Haut auf Substanzen direkt
anzeigt: Die Reporterhaut. Durch den eingebauten Reporter kann die
zelluläre Antwort präzise und schnell gemessen werden – und das am
lebenden Modell. So lassen sich nicht nur Kosmetika wirkungsvoll prüfen,
sondern auch Allergene sowie entzündungsauslösende oder toxische Wirkungen
von Bioziden, Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien.
In Shampoos, Cremes und Make-ups steckt eine ganze Palette verschiedener
Substanzen. Bevor ein neues kosmetisches Produkt auf den Markt kommt,
müssen dessen Inhaltsstoffe auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet
werden. So schreibt es die europäische Gesetzgebung vor. Was ebenfalls EU-
weit gesetzlich reguliert ist: Tierversuche sind hierfür schon lange nicht
mehr erlaubt und seit 2013 dürfen Kosmetika, die an Tieren getestet
wurden, in der EU nicht mehr vermarktet werden. Auch Pflanzenschutzmittel,
Biozide und alle weiteren Chemikalien müssen nach der europäischen
Chemikalienverordnung (REACH) hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials,
beispielsweise einer allergenen oder entzündungsauslösenden Wirkung
getestet werden – nach Möglichkeit ohne Tierversuche.
Tierversuchsfreie Alternativmethoden sind daher gefragt. Hersteller setzen
hierzu etwa im Labor gezüchtete Haut-Zellkulturen ein, wenn sie neue
Inhaltsstoffe oder Rezepturen entwickeln und erproben. Hierbei wachsen die
Hautzellen in einer Zellkulturschale mit Kulturmedium, das sie mit
Nährstoffen versorgt und sie vollständig umgibt. Dies erschwert das Testen
fester oder öliger Substanzen. Auch In-vitro-Hautmodelle, im Labor
gezüchtete Gewebe aus Hautzellen, sind als Testsysteme bereits auf dem
Markt verfügbar. Ihr Nachteil: Um die Wirkung der Testsubstanz zu
analysieren, muss das In-vitro-Gewebe präpariert und mikroskopisch
untersucht werden. Für Untersuchungen einer hautreizenden Wirkung, die
erst nach wiederholter Verabreichung der Substanz auftreten kann, wird
daher eine immens große Anzahl identischer Hautmodelle benötigt.
Mehr Aussagekraft durch dreidimensionales Hautmodell mit Hautbarriere
Forschende am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und
Bioverfahrenstechnik IGB haben ein dreidimensionales Hautmodell aus
humanen Zellen etabliert, das die komplexe Physiologie der Haut
einschließlich einer intakten Hautbarriere sehr gut abbildet und daher
wesentlich aussagekräftigere Ergebnisse liefert als einlagige
Zellkulturen. Das patentierte Hautmodell besteht aus dermalen
Fibroblasten, den Zellen der Unterhaut, die in eine Kollagenmatrix
eingebettet sind, sowie aus Keratinozyten, die eine voll differenzierte
mehrschichtige Epidermis bilden. »Diese bildet, genau wie die natürliche
Haut, eine Hornschicht, welche als wirksame Barriere gegenüber äußeren
Einflüssen fungiert«, erläutert Dr. Anke Burger-Kentischer,
Abteilungsleiterin Zell- und Gewebetechnologien am Fraunhofer IGB.
Die Zellen für das Hautmodell, die Fibroblasten und die Keratinozyten,
isolieren die Wissenschaftler aus Hautproben, die bei chirurgischen
Eingriffen in Arztpraxen und Krankenhäusern als Abfallprodukte anfallen.
Direkt aus dem Ursprungsgewebe isoliert, ähneln diese Zellen – im
Gegensatz zu kommerziellen Zelllinien aus Tumorgeweben – den Zellen in
vivo und weisen eine normale Physiologie auf. Die isolierten primären
Zellen werden dann zunächst immortalisiert, damit sie dauerhaft
kulturfähig werden und unbegrenzt zur Verfügung stehen. Damit können die
Hautmodelle reproduzierbar aufgebaut werden und spenderunabhängige
Ergebnisse liefern.
Präzises Testergebnis am lebenden Modell durch Reporterfunktion
Der Clou des Hautmodells aber liegt an seiner eingebauten
Reporterfunktion. Mit sogenannten Reportern kann die Expression eines
relevanten Gens einfach und zugleich zuverlässig überwacht werden. »Wir
koppeln das Reportergen an den Signalweg für eine zelluläre Signalkaskade,
die bei Hautstressreaktionen eine Rolle spielt, und verankern das
Konstrukt stabil im Genom unserer immortalisierten Keratinozyten«, erklärt
Burger-Kentischer ihren wegweisenden Ansatz. Bei Entzündungsreaktionen
beispielsweise fungiert der zur Signalkaskade zugehörige Rezeptor in der
Membran der Hautzelle als Schnittstelle zur Außenwelt: Bindet die zu
untersuchende Substanz an den Rezeptor, aktiviert dies die Signalkaskade
und über die Kopplung des Reportergens an den Transkriptionsfaktor – als
letzten Dominostein der zellulären Antwort – wird auch das Reportergen
abgelesen und das Reporterprotein produziert.
Als Reporter setzt Burger-Kentischer unter anderem die sezernierte
alkalische Phosphatase ein, ein Enzym, das sein Substrat in einen gelben
Farbstoff umwandelt. »Für unsere Reporterhaut bedeutet das: Wir nehmen
nach Applikation der Testsubstanz eine Probe aus dem Kulturüberstand des
Hautmodells, geben das Substrat der alkalischen Phosphatase hinzu und
können den Farbumschlag bereits nach wenigen Minuten bis Stunden messen,
sofern die Signalkaskade in Gang gesetzt wurde«, so die Wissenschaftlerin.
Da die Zellen der Reporterhaut für die Auswertung nicht zerstört werden
müssen, kann zudem der zeitliche Verlauf der Zellreaktion verfolgt werden.
»Mit unserer Reporterhaut können wir die In-vivo-Situation realitätsnah
nachstellen und Zellreaktionen in Echtzeit analysieren. Damit stellt sie
eine sehr spezifische und dazu kostengünstige Alternative zu den
bisherigen Modellen dar, weil das Gewebe nicht mit vielen
aufeinanderfolgenden und aufwendigen Schritten fixiert, immunhistochemisch
gefärbt, geschnitten und mikroskopiert werden muss, um die Veränderungen
der Zellen zu erkennen und auszuwerten«, so die Wissenschaftlerin.
Testsystem auch für wasserabweisende und feste Substanzen geeignet
»Mit unserer Reporterhaut erhalten wir viel aussagekräftigere Ergebnisse
als bei Modellen ohne Hautbarriere und können, anders als bei submersen
Zellkulturen, wesentlich mehr Chemikalien und Substanzgemische prüfen:
auch die wasserabweisenden, die im wässrigen Zellkulturmedium keine
stabile Dispersion bilden«, ergänzt Burger-Kentischer. Für Hersteller von
Kosmetika und Chemikalien bedeutet dies, dass mit dem dreidimensionalen
Reporterhaut-Modell erstmals Öle oder Ölgemische untersucht werden können,
oder auch feste Stoffe wie Textilien und Lebensmittel.
Nachweis von Zytotoxizität, Sensibilisierung, Entzündung und
Hautpenetration im selben Modell
Burger-Kentischer ist es mit ihrem Team sogar gelungen, verschiedene
zelluläre Signalwege mit jeweils unterschiedlichen Reportern in dem
gleichen Hautmodell zu integrieren. Damit steht mittlerweile ein ganzes
Set von 3D-Reporterhautmodellen für verschiedenste Anwendungen zur
Verfügung.
»So können wir Aussagen über das toxikologische Potenzial einer Substanz
treffen, die Hautpenetration einer Substanz untersuchen sowie spezifisch
und schnell die Aktivierung verschiedener zellulärer Stresssignalwege
durch die Substanz in demselben Modell auslesen«, so Burger-Kentischer.
Hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Aussagekraft übertreffen diese
Modelle damit die am Markt vorhandenen Testsysteme erheblich.
Über die Abbildung aller drei bekannten Hautstress-Signalwege erhalten
Hersteller von Kosmetika und Chemikalien schnell eine Antwort darauf, ob
und welche Art von Zellstress eine Substanz hervorruft: Ob sie
beispielsweise entzündlich wirkt oder die Haut sensibilisiert und damit
langfristig zu einer Allergie führen kann. Oder ob sie mit ER-Stress
reagiert, in dessen Folge Proteine falsch gefaltet werden und damit ihre
biologische Funktion nicht mehr ausüben können.
Integration weiterer Wirkungsnachweise möglich
Ob das Reporterhautmodell für eine Herstellerfirma tatsächlich geeignet
ist, kann das Team um Burger-Kentischer vorab im institutseigenen Labor
überprüfen, bevor es die In-vitro-Modelle in großer Zahl für Interessenten
herstellt. Auf Kundenwunsch kann das Reporter-Testsystem zudem um weitere
zelluläre Signalwege ergänzt oder auf andere Organe übertragen werden.
- Aufrufe: 19