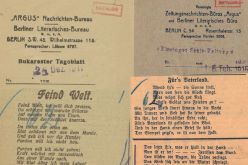Evangelische Hochschule eröffnet Akademisches Jahr 2024/2025 mit Festakt und zeichnet herausragende Leistungen aus
Die Evangelische Hochschule Freiburg hat das Akademische Jahr 2024/2025
feierlich eröffnet. In ihrer Begrüßungsrede appellierte Rektorin Prof.in
Dr.in Renate Kirchhoff an die Gäste, sich gemeinsam für die Stärkung der
Sozialwirtschaft einzusetzen. Diese brauche eine breitere Lobby, denn die
Sozialwirtschaft sei der ‚Kitt‘ der Gesellschaft. Festredner war Präsident
Prof. Dr. Norbert Palz, Universität der Künste Berlin. Sein Thema, wie
Diskursräume offengehalten werden können, wurde mit einem Podiumstalk
vertieft. Daran nahmen teil: Professor Palz, Hanna Böhme,
Geschäftsführerin FWTM und Soziologieprofessorin Nina Wehner, moderiert
von Melanie Hussak vom Friedensinstitut
„Der aktuelle Rückgang an Studierendenzahlen bei gleichzeitig erheblichem
Fachkräftemangel führt zu einem Druck auf die Hochschulen, ihre
Studienplätze „voll zu kriegen“. Für Studierendengewinnung ist die
entscheidende Frage: wie attraktiv sind die beruflichen Handlungsfelder?“,
betonte die Rektorin.
Um Studierende zu gewinnen und zu halten, unternimmt die Evangelische
Hochschule eine Vielzahl an Maßnahmen, die unterschiedlichste Interessen
bedienen. „Wir sind auf mehreren sozialen Medien aktiv, bieten online und
in Präsenz Beratungsgespräche an: durch unsere Studienberaterin,
Hochschullehrende und Studierende in der Phase vor der Immatrikulation und
auch während des Studiums. Wir werben mit einer Studieneingangsphase, die
Schreibwerkstätten und Beratung zu „Gesund Studieren“ bietet. Hierfür
nutzen wir Erkenntnisse aus einem eigenen Forschungsprojekt zu Resilienz
im Studium", so Kirchhoff.
Sie ergänzte: „In der Eingangsphase veranstalten die Kolleg*innen eine Art
Planspiel, in der die Studienanfänger*innen ihre Handlungsmöglichkeiten im
Feld und auch politisch ausleuchten: Die Perspektive auf
Gestaltungsmöglichkeiten erhöht die Lust auf den Beruf. Wir bieten
individualisierte Studienverläufe und ermöglichen Berufs- oder
Caretätigkeit neben dem Studium. Wir bieten Beratung aller Studierenden
bei Prokrastination, und wir haben ein transparentes System, wie wir z.B.
an Beratungsstellen verweisen: denn psychische Probleme haben zugenommen.
Nicht zuletzt haben wir Kipäd plus aufgegleist: die systematische
Anwerbung von Pädagog*innen mit internationalem Studienabschluss, z.B. aus
Spanien und der Ukraine. Eingefädelt in den Bachelor Kindheitspädagogik
werden sie in den deutschen Arbeitsmarkt einmünden. Dieses Programm wird
wirksam ab dem Wintersemester 2025/26."
"Studienplätze sind nicht in erster Linie aufgrund des Studiums selbst
nachgefragt seien, sondern weil Studierende damit eine berufliche
Perspektive wählen. Für die Studierendengewinnung ist daher die
entscheidende Frage: Wie attraktiv sind die beruflichen Handlungsfelder?",
betonte die Rektorin.
Am Beispiel der Kindheitspädagogik skizzierte Kirchhoff die Situation der
sozialen Berufsfelder. Die Arbeit im Feld der Kindheitspädagogik – also
Krippe, Kita, Frühe Hilfen, Ganztag, offene und stationäre Kinder- und
Jugendarbeit, Schulsozialarbeit etc. habe sich durch gesellschaftliche
Entwicklungen der letzten Jahre erheblich verändert: mehr kulturelle
Vielfalt, mehr Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten
und/oder psychischen Auffälligkeiten. Zielgruppen der Fachkräfte seien
längst nicht mehr allein die Kinder, sondern auch die erwachsenen
Bezugspersonen der Kinder. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
müssten allgemeine gesellschaftliche Aufgaben alltäglich gestaltet werden.
Rektorin Kirchhoff ist überzeugt, dass die Aufgaben bewältigt werden
können, „wenn Fachkräfte auch fachlich arbeiten können“. Sie ergänzte:
„Das Feld ist für sie attraktiv, wenn sie den eigenen fachlichen
Ansprüchen gerecht werden können. Doch je weniger Fachkräfte, je mehr
Deprofessionalisierung: desto unattraktiver wird das Arbeitsfeld – und
übrigens: umso gefährdeter sind das soziale Miteinander, Integration,
Teilhabe und Demokratiefähigkeit der Gesellschaft – und auch die
Wirtschaftskraft des Landes.“
Spezifisch für den SAGE Bereich - Soziale Arbeit, Gesundheit, Bildung,
Erziehung und bei uns auch Angewandte Theologie - sei, so Kirchhoff, dass
seine Themen keine Lobby in den Finanzverhandlungen des Landes hätten:
„Hier brauchen nicht nur wir als Hochschulen, sondern unsere Gesellschaft
eine gemeinsame Anstrengung: die Unterstützung von Akteur*innen aus
Politik, Wirtschaft, Kirche, Stadtgesellschaft und Bildung, um bei
politischen Entscheidungsträgern einen Willen zu erzeugen, den Bereich der
Sozialwirtschaft strategisch und also auch in den Finanzverhandlungen zu
berücksichtigen."
Festredner Präsident Prof. Dr. Norbert Palz führte aus: "Die aktuelle
junge Generation ist in einer bedauernswerten Lage der Unsicherheit, und
ihre Aussichten sind deutlich trüber als noch zu meiner Studienzeit. ...
Sie sucht nach Wegen der Alltagsbewältigung und einer sinnvollen
Lebensführung im kritischen Bewusstsein über Fehler und Nachlässigkeiten
meiner Generation. Doch besteht die Gefahr, dass diese verwundbare
Generation im Dienste der Handlungsfähigkeit einer mechanistischen,
vereinfachenden Lösungsstrategie anheimfällt. Die mit groben Strichen
gezeichnete Einteilung in Täter und Opfer verfehlt in der daraus energisch
formulierten Kritik seine Wirkungsmacht. Die daraus präsentierten
Forderungskataloge, die Leitungsfiguren erhalten, verstoßen nicht selten
gegen rechtliche Grundbedingungen oder sind schlichtweg nicht mit einer
universitären Kultur des Austauschs und der Gleichberechtigung vereinbar."
Er stellte heraus, dass neben einer Kultur der Wertschätzung Vertrauen und
gegenseitige Zuversicht elementare Bestandteile eines produktiven
Diskurses seien. Palz: "Wenn Konflikte selbst einen Wert darstellen, ist
der Weg zu einer Lösung verstellt."
Herausragende Leistungen von Hochschulmitgliedern ausgezeichnet
Im Rahmen des Festakts hat die Evangelische Hochschule
Wissenschaftler*innen mit Team für ihre innovative Lehre ausgezeichnet.
Der Lehrpreis der Hochschule für die besonders gelungene und beispielhafte
Gestaltung eines innovativen Lehr-Lern-Settings wurde für an zwei
Lehrveranstaltungen vergeben.
Der erste Lehrpreis ging an Sibylle Fischer, M.A., und Prof.in Dr.in Gesa
Köbberling für das Schwerpunktseminar „Handlungsfeld Sozialraumorientierte
Soziale Arbeit in der postmigrantischen Stadt".
Der zweite Lehrpreis wurde verliehen an Prof.in Dr.in Maike Rönnau-Böse im
Team mit Juliane Cichecki, M.A., Dr.in phil. Stefanie Pietsch, Prof.in
Dr.in Stefanie Engler und Julien Collonges für die „Writing Night – Lange
Schreibnacht im Rahmen des Projekts 'Stark studieren!'".
Studierende der Hochschule wurden für herausragende Abschlussarbeiten und
für gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.
Der Dr.-Julie-Schenck-Preis der Evangelischen Landeskirche in Baden,
überreicht durch Joost Wejwer, Landeskirchlicher Beauftragter für
Diakon*innen in Baden, ging an Florian Selz (Religionspädagogik).
Gewürdigt wurde damit insbesondere sein kirchliches und soziales
Engagement, z.B. für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, bei der
Gestaltung von Gottesdiensten in Kirchengemeinden, aber auch an der
Hochschule, sein Engagement im Verein Christ:in & queer. Zwischenraum e.V.
und im „Pacingteam Freiburg“, einer Initiative für Long-Covid- und ME/CFS-
Erkrankungen. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.
Mit dem Studienpreis des Diakonischen Werks Baden, übergeben durch Holger
Hoffmann, stellvertretender Vorstand, wurde Niklas Baumer (Soziale Arbeit)
für seine Thesis „Antidiskriminierungsarbeit und die Perspektive der
Beratenden - Eine Untersuchung des Selbstverständnisses im Kontext
gesellschaftlicher Positioniertheit" ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt
1000 Euro.
Zoe Kraus (Kindheitspädagogik) erhielt den Studienpreis der EH Freiburg,
überreicht durch Rektorin Renate Kirchhoff für ihre Abschlussarbeit
„Ästhetische Bildung in Kindertagesstätten im Alter von 1- 6 Jahren.
Dimensionen ästhetischer Bildung unter besonderer Berücksichtigung
künstlerischer Medien". Dieser Studienpreis ist mit 1000 Euro dotiert.
Der Studienpreis des Studierendenwerks Freiburg wurde von Geschäftsführer
Clemens Metz übergeben. Preisträgerin ist Anna Nell (Soziale Arbeit).
Prämiert wurde ihre Thesis „Gelingensfaktoren bei der Umsetzung der
finnischen Housing First Strategie. Handlungsempfehlungen für deutsche
Städte". Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.
- Aufrufe: 155