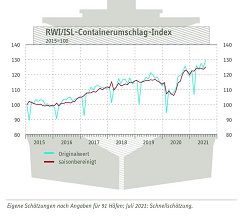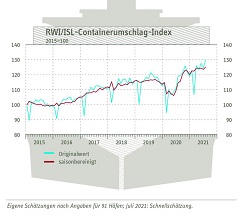Bundeswirtschaftsministerium erweitert den Förderwettbewerb Energieeffizienz um Ressourcen
Der Förderwettbewerb Energieeffizienz des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) wird um eine neue Fördermöglichkeit für
Ressourceneffizienz ergänzt und startet zum 1. November in die nächste
Runde. Unternehmer, die den Energie- und Ressourcenverbrauch in ihrem
Betrieb senken wollen, können künftig über die Hälfte ihrer Investitionen
vom BMWi bezuschussen lassen. Anträge können ab 1. November eingereicht
werden.
Das neue Förderangebot richtet sich an Unternehmen aller Branchen und
Größen, darunter auch Stadtwerke und Energiedienstleister. Es adressiert
vor allem Projekte mit hohen energie- und ressourcenbezogenen
Investitionskosten, die für eine wirtschaftliche Umsetzung Unterstützung
benötigen. Die Unternehmen entscheiden im vorgegebenen Rahmen selbst,
wieviel Förderung sie für die geplante Effizienzmaßnahme beantragen. Das
Bundeswirtschaftsministerium fördert dann jene Projekte, welche die
höchste jährliche CO2-Einsparung pro beantragtem Euro Förderung und damit
die höchste Fördereffizienz erreichen.
Die aktuelle Wettbewerbsrunde läuft vom 1. November 2021 bis zum 28.
Februar 2022. Anträge können beim Projektträger VDI/VDE Innovation +
Technik GmbH eingereicht werden.
Der BMWi-Wettbewerb Energie-und Ressourceneffizienz auf einen Blick:
• technologie- und branchenoffene Förderung von Maßnahmen zur
energetischen Optimierung industrieller und gewerblicher Anlagen und
Prozesse (u.a. Abwärmenutzung, EE-Prozesswärmebereitstellung)
• zweistufiges Antragsverfahren mit Skizze und anschließendem Online-
Einsparkonzept
• Zuschuss bis zu 60 % der förderfähigen Kosten
• maximal 10 Mio. Euro Förderung pro Vorhaben
• kontinuierliche Antragstellung mit mehreren Stichtagen im Jahr
• Fördereffizienz als zentrales Kriterium für die Förderentscheidung
Weitere Informationen zum BMWi-Wettbewerb Energie- und Ressourceneffizienz
unter: http://www.wettbewerb-energiee
310078-5555 (Beratungs-Hotline)
- Aufrufe: 77