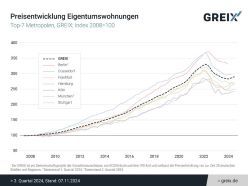Medica 2024: Master-Fernstudiengang macht Fachkräfte fit für die Digitalisierung im Sport- und im Gesundheitssektor
Sensorgestützte Trainingsgeräte und Diagnostik ermöglichen im
organisierten Sport und in der Gesundheitsbranche grundlegend neue
datenbasierte Trainings- und Therapieansätze. Die Nachfrage nach
Fachkräften, die sich mit der grundlegenden Technik sowie Datenmanagement
auskennen, ist entsprechend hoch. Dem Bedarf trägt die RPTU mit dem
berufsbegleitenden Master-Fernstudiengang „Sport- und
Gesundheitstechnologie“ Rechnung, der zum aktuellen Wintersemester
gestartet ist. Auf der Medica können sich Interessierte vom 11. bis 14.
November am Gemeinschaftsstand Rheinland-Pfalz (Halle 3, Stand E92) über
Ablauf und Inhalt des neuen Fernstudienangebots informieren.
Leistungsdiagnostik, Bewegungs- und Haltungsanalyse auf neuem Niveau:
Digitale Tools und Technologien, die vielfältige Fitness- und
Gesundheitsdaten messen und per Algorithmus auswerten, durchdringen
zunehmend den Sport- und Gesundheitsmarkt. Der digitale Wandel erschließt
neues Potenzial, stellt aber ebenso neue Anforderungen an Fachkräfte, die
in diesen Bereichen tätig sind. Die erforderlichen Kompetenzen und
Qualifikation vermittelt der berufsbegleitende Master-Fernstudiengang
„Sport- und Gesundheitstechnologie“, in dem er Wissen aus Informatik,
Technik sowie der Sport- und Gesundheitswissenschaft verbindet.
Praxisorientiert und flexibel studieren
„Die interdisziplinäre Ausrichtung des weiterbildenden Fernstudiengangs
befähigt Fachkräfte, Brücken zwischen verschiedenen Fachgebieten zu
schlagen, innovative Lösungen zu entwickeln und macht sie so fit für die
digitale Zukunft“, erläutert die Programmmanagerin und
Sportwissenschaftlerin Eva Bartaguiz. „Im Studienverlauf beschäftigen sich
Fernstudierende unter anderem mit Datenverarbeitung, Künstlicher
Intelligenz, Mensch-Maschine-Interaktion, Biomechanik, Sportmedizin,
Statistik und Projektmanagement. Zudem lernen sie, wie man Testverfahren
durchführt sowie datenbasierte Trainings- und Therapieempfehlungen
erarbeitet – alles mit Blick auf praktische Anwendungen, insbesondere den
Einsatz von sensorgestützten Trainingsgeräten und Diagnostikverfahren.“
Dabei kombiniert der viersemestrige deutschsprachige Fernstudiengang
wissenschaftliche und praxisorientierte Anteile aus Sport, Gesundheit und
Informatik in einem ausgewogenen Verhältnis miteinander. Er richtet sich
an alle Interessierten, die innovative Technologien in Sport und
Gesundheit verstehen sowie Informatik mit Sport- und
Gesundheitswissenschaft verknüpfen und das Gelernte praktisch in einem
Berufsfeld im Sport- und Gesundheitssektor anwenden möchten.“ Das Studium
erfolgt berufsbegleitend, überwiegend orts- und zeitunabhängig. Die
Lerneinheiten lassen sich so flexibel in den Alltag integrieren.
Die Konzeption und der Aufbau des Studiengangs wurden vom 1. Juli 2022 bis
30. September 2024 vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wissenschaft
und Gesundheit und vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit,
Soziales, Transformation und Digitalisierung aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds Plus (ESF+) mit 268.000 € gefördert.
Fernstudium an der RPTU
Mit derzeit rund 30 berufsbegleitenden Masterstudiengängen und
Zertifikatsprogrammen ist die RPTU einer der renommiertesten
Fernstudienanbieter an einer staatlichen Universität in Deutschland. Das
Weiterbildungsangebot umfasst Sozial-, Wirtschafts-, Rechts-, Natur- und
Ingenieurwissenschaften. Fernstudierende erwerben an der RPTU die
Kompetenzen und Qualifikationen, um mit neuen bzw. sich wandelnden
Anforderungen des Arbeitsmarktes Schritt zu halten. Neben dem Master-
Studiengang „Sport- und Gesundheitstechnologie“ ist im aktuellen
Wintersemester auch der Master-Studiengang „Quantum Technologies“ neu
gestartet, der Kenntnisse im Bereich der Quantentechnologien vertieft. Ab
dem Wintersemester 2025/26 wird zudem der Studiengang „Nachhaltige
Architektur und Technik“ das Angebot erweitern.
- Aufrufe: 233