Älter, vielfältiger, aber keine CO2-Senke mehr: So steht es um Deutschlands Wälder
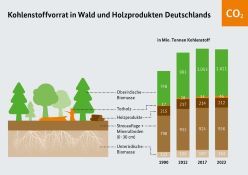
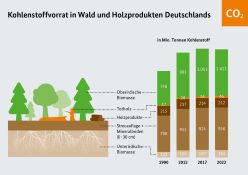
Mit dem heutigen Tag liegen die Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2022
vor. Das Ergebnis der umfangreichsten Bestandsaufnahme im deutschen Wald
hat Licht und Schatten. Die Wälder werden strukturreicher, es gibt mehr
ältere Bäume und etwas mehr bewaldete Fläche. Die durchschnittliche
Kohlenstoff-Speicherleistung des Waldes hat allerdings seit 2012 deutlich
abgenommen. Zwischen 2017 und 2022 wurden die Wälder sogar zur
Kohlenstoff-Quelle.
Eberswalde (08. Oktober 2024). Die Ergebnisse der vierten
Bundeswaldinventur (BWI) zeigen ein differenziertes Bild der
Waldentwicklung: Einerseits gibt es in Deutschland seit 2012 etwas mehr
Waldfläche, es stehen mehr Laubbäume in den Wäldern und die Naturnähe
nimmt langsam, aber beständig zu. Andererseits hat der Wald in der zweiten
Hälfte der Dekade durch Trockenheit und Schädlingsbefall so stark
gelitten, dass der Holzvorrat und damit auch der Kohlenstoffvorrat seit
2017 erheblich abgenommen haben. „Aktuell ist ungefähr die gleiche Menge
Kohlenstoff in der lebenden Biomasse im Wald gespeichert wie vor zehn
Jahren. Bis 2017 hat die gespeicherte Kohlenstoffmenge um 52 Millionen
Tonnen zugenommen. Danach hat die lebende Biomasse allerdings 42 Millionen
Tonnen Kohlenstoff in Totholz und Holzprodukte abgegeben“, erläutert Dr.
Thomas Riedel, Leiter der BWI am Thünen-Institut für Waldökosystem in
Eberswalde, die Zahlen. Totholz zersetzt sich und gibt dabei den
Kohlenstoff in Form von Humus an den Boden und als Kohlendioxid (CO2) an
die Atmosphäre ab. „Werden aus dem Holz langlebige und hochwertige
Holzprodukte, bleibt das Kohlendioxid hingegen im Durchschnitt noch 30
weitere Jahre gebunden“, so Riedel. Durch den massiven Verlust an lebender
Biomasse ist der Wald seit 2017 von einer Kohlenstoff-Senke zu einer
Kohlenstoff-Quelle geworden.
Deutschlands Wälder werden alle zehn Jahre inventarisiert. 100
Inventurtrupps vermessen mehr als 520.000 Bäume und beschreiben an 80.000
genau definierten Punkten in den Wäldern, was sie vorfinden: Anzahl, Art
und Durchmesser der Bäume, den Bewuchs darunter, das Totholz – insgesamt
werden knapp 150 Kriterien aufgenommen. Die BWI ist das Kontrollinstrument
der nachhaltigen Waldwirtschaft, gemäß Bundeswaldgesetz gemeinsam
organisiert von Bund und Ländern. 2021 und 2022 fand sie zum vierten Mal
statt. Das Thünen-Institut koordiniert die BWI im Auftrag des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und wertet sie
aus. Berechnet werden unter anderem Waldfläche, Holzvorrat, Holzzuwachs
und Holznutzung, Baumartenvielfalt, Altersaufbau, Totholz und Naturnähe
sowie Biomasse und Kohlenstoffspeicherung. Erstmals wurden bei der
aktuellen BWI Proben zur Ermittlung dergenetischen Vielfalt gesammelt. Für
regionale Auswertungen werden zusätzlich zu den vor Ort gesammelten Daten
auch Fernerkundungsdaten verwendet.
Ausgewählte Ergebnisse
Weniger Kohlenstoffvorrat: Seit 2017 ist der Wald vor allem durch den
klimawandelbedingten Verlust an lebender Biomasse zur Kohlenstoff-Quelle
geworden. Aktuell sind 1.184 Millionen Tonnen Kohlenstoff oder 108 Tonnen
Kohlenstoff je Hektar in den lebenden Bäumen und 46,1 Millionen Tonnen
oder 4,2 Tonnen je Hektar im Totholz gebunden. Weitere 936 Millionen
Tonnen Kohlenstoff sind nach Ergebnissen der Bodenzustandserhebung in
Streu und Mineralboden eingelagert. Insgesamt sind also rund 2.200
Millionen Tonnen Kohlenstoff im Wald gespeichert. Der Kohlenstoffvorrat
der lebenden Biomasse im Wald hat im Vergleich zur letzten BWI 2012 zwar
um ein Prozent zugenommen. Seit der Kohlenstoffinventur 2017 ging er
allerdings um 41,5 Millionen Tonnen oder drei Prozent zurück. Da der
Kohlenstoffverlust in der lebenden Biomasse in den Jahren 2017 bis 2022
höher war als die Zunahme beim Totholz und auch der Boden nicht mehr
Kohlenstoff gespeichert hat, ist der Wald in diesem Zeitraum zu einer
Quelle für Kohlendioxid geworden.
Mehr Waldfläche: Obwohl 66.000 Hektar Wald seit der letzten BWI im Jahr
2012 in Grünland oder für andere Nutzungen umgewidmet wurden, hat die
Waldfläche durch Neuaufforstungen insgesamt um 15.000 Hektar zugenommen.
Derzeit gibt es 11,5 Millionen Hektar Wald in Deutschland. Das heißt, ein
Drittel der Landfläche ist mit Wald bedeckt.
Mehr Vielfalt: Mit 79 Prozent Flächenanteil sind Mischwälder die prägende
Form. Seit 2012 ist der Flächenanteil um drei Prozent gewachsen.
Nadelwälder kommen immer noch vergleichsweise häufig als Reinkulturen vor:
Lediglich 61 Prozent der Kiefern- und 75 Prozent der Fichtenwälder sind
durchmischt. Alle anderen Waldflächen sind stärker gemischt.
Mehr Naturverjüngung: Auf rund drei Millionen Hektar Wald wächst bereits
eine neue Generation an Bäumen heran. 91 Prozent davon sind auf
Naturverjüngung zurückzuführen. Gegenüber der letzten BWI hat diese um
weitere sechs Prozentpunkte zugenommen.
Mehr Laubholz, weniger Fichte: Kiefer, Fichte, Buche, Eiche – diese vier
Baumarten bestimmen das Antlitz von 71 Prozent der Wälder. Doch das Bild
wandelt sich. War die Fichte bisher die dominierende Nadelbaumart, so hat
sich dies bedingt durch Stürme, Dürren und die massenhafte Vermehrung des
Borkenkäfers deutlich geändert. Sie hat im Vergleich zur BWI 2012 rund
460.000 Hektar an Fläche verloren. Fichte findet sich noch auf 2,3
Millionen Hektar bzw. auf 20,9 Prozent der Waldfläche. Mit 2,4 Millionen
Hektar Fläche ist mittlerweile die Kiefer zur Baumart mit der größten
Verbreitung geworden. Doch auch sie verliert im Klimawandel – minus 41.000
Hektar seit 2012.
Bei den häufigen Laubholzarten Buche und Eiche sind die Flächenanteile um
jeweils mehr als ein Prozent gestiegen (Buche: auf 16,6 Prozent, Eiche:
auf 11,5 Prozent). Aktuell zeigen sich jedoch bei beiden Arten
Trockenstress-Symptome, die während der Erhebungen zur BWI 2022 noch nicht
sichtbar waren.
Mehr alte Bäume: Im Vergleich zur BWI 2012 sind die Wälder in Deutschland
älter geworden. 2022 waren mehr als 30 Prozent des Waldes älter als 100
Jahre, mehr als 20 Prozent älter als 120 Jahre. Bei der Inventur 2012
waren nur 14 Prozent der Wälder älter als 120 Jahre. Der Wald war im Jahr
2022 durchschnittlich 82 Jahre alt – fünf Jahre älter als noch 2012.
Die Zunahme alter Bäume fördert die biologische Vielfalt im Wald. Alte
Bäume verfügen häufiger als junge Bäume über besondere Mikrohabitate wie
Grobborke, Kronentotholz, Brettwurzeln, Astabbrüche oder Spechthöhlen.
Viele, auch seltenere, auf bestimmte Zerfallsphasen spezialisierte Arten
sind auf diese Mikrohabitate angewiesen. Das zunehmende Alter der Bäume
senkt allerdings die Möglichkeit, zusätzlichen Kohlenstoff im Wald
einzubinden. Zum einen nimmt der Zuwachs je Hektar im hohen Alter ab. Zum
anderen müssten Arten in die vorhandenen Wälder integriert werden, die im
Klimawandel besser an den Standort angepasst sind. Die Konsequenz: Auch
alte Bäume sollten genutzt werden, um das Durchschnittsalter im Wald zu
senken. Zur Förderung der Biodiversität sollten ökologisch besonders
wertvolle Baumindividuen im Wald stehen bleiben.
Weniger Holzzuwachs: Der Holzzuwachs betrug rund 9,4 Kubikmeter je Hektar
und Jahr, insgesamt 101,5 Millionen Kubikmeter jährlich – ein Minus von 16
Prozent im Vergleich zur Bundeswaldinventur 2012. Der starke Rückgang ist
vor allem auf drei Ursachen zurückzuführen: die Folgen des Klimawandels
wie Stürme, Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten, der Ausfall der
schnellwüchsigen Fichte und die fortschreitende Alterung des Waldes.
Mehr Totholz: Durch Sturm, Dürre und Borkenkäferbefall hat auch die
Totholzmenge im Wald zugenommen. Insbesondere in den Bundesländern Hessen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Schadholzmenge seit
2018 erheblich angestiegen. Insgesamt wurden allein im Jahr 2020
deutschlandweit 60,1 Millionen Kubikmeter Kalamitätsholz ungeplant
geschlagen, der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1990. Der
Anteil des Kalamitätsholzes am gesamten Holzeinschlag lag bei knapp 75
Prozent.






